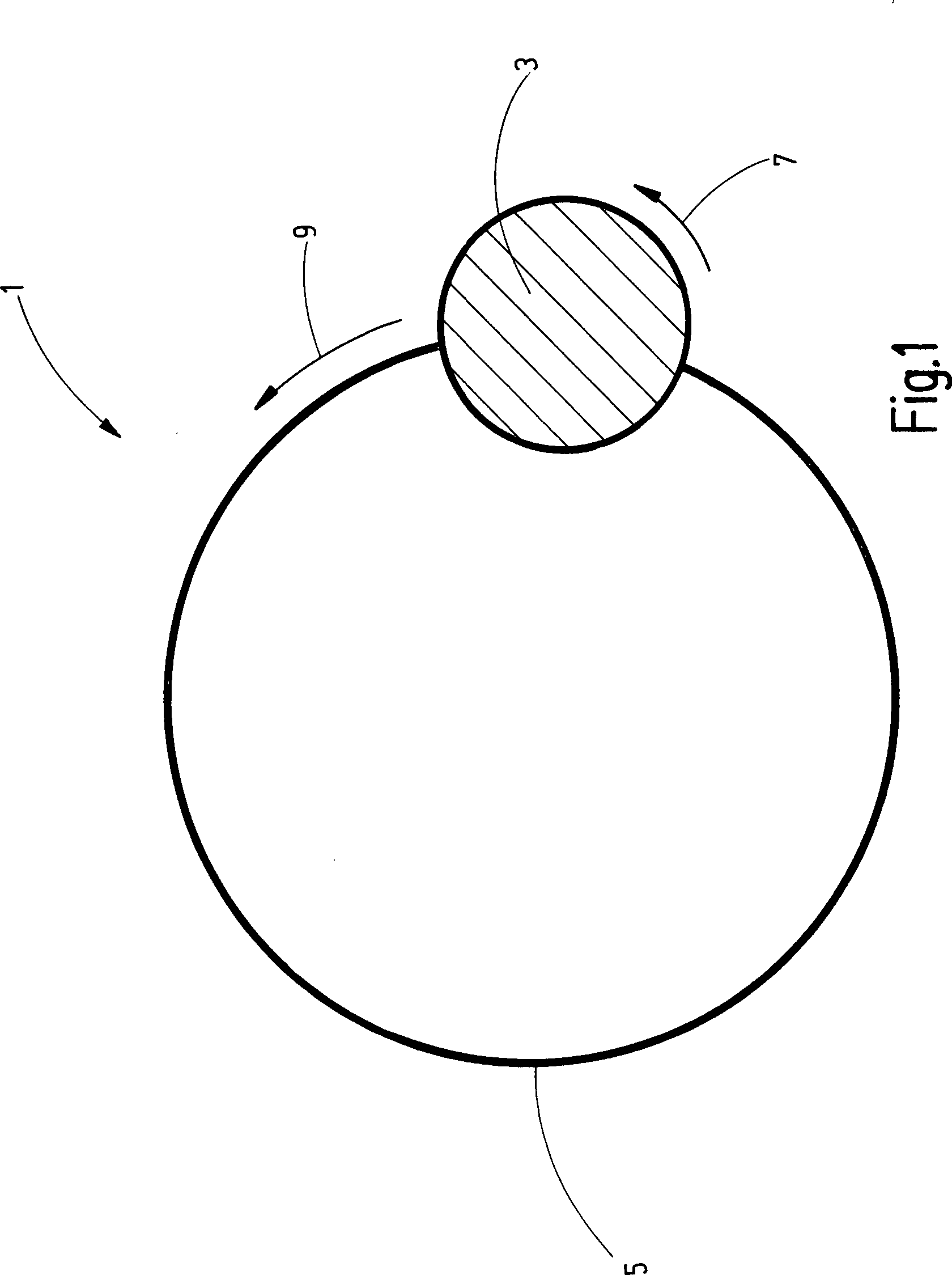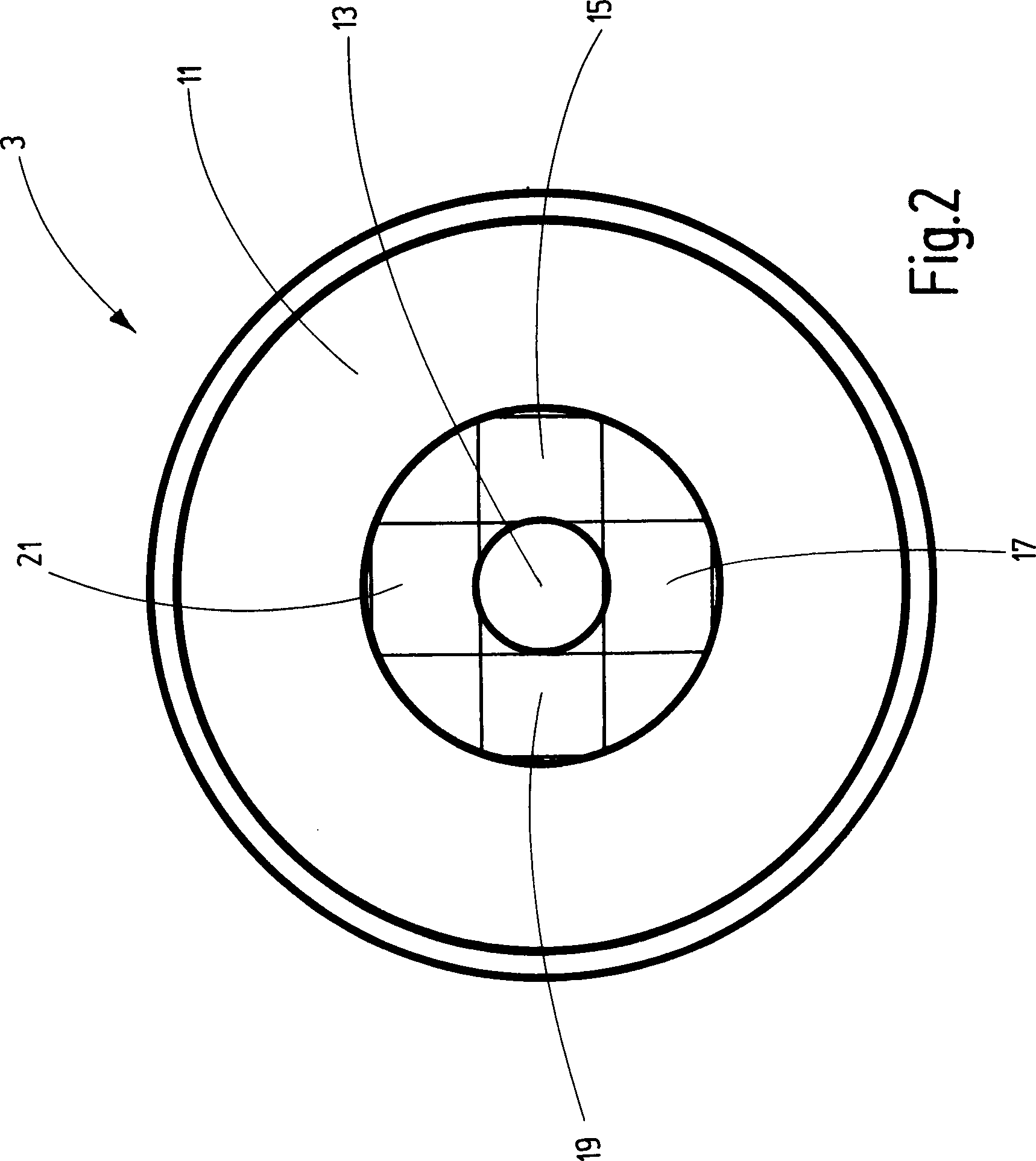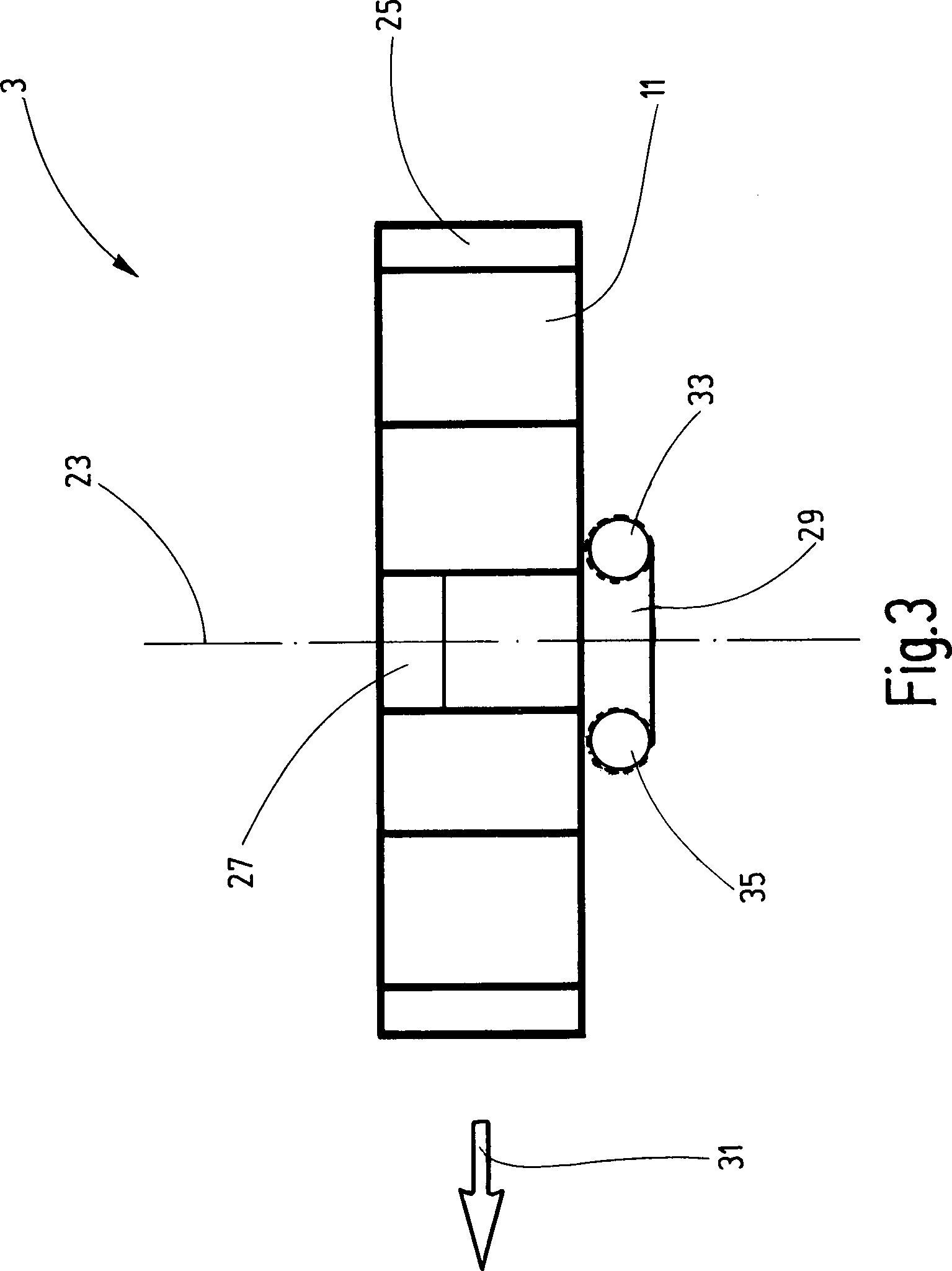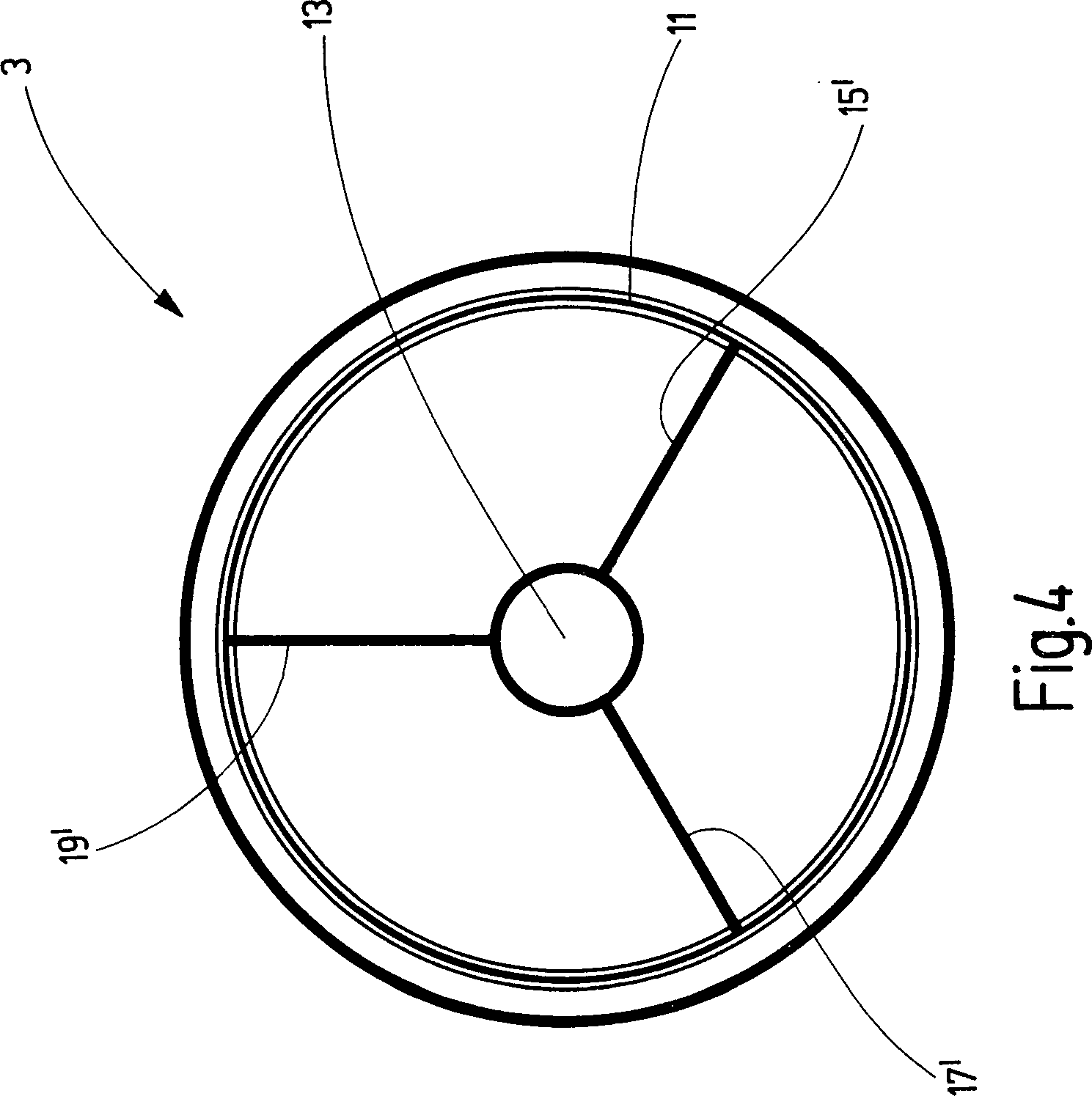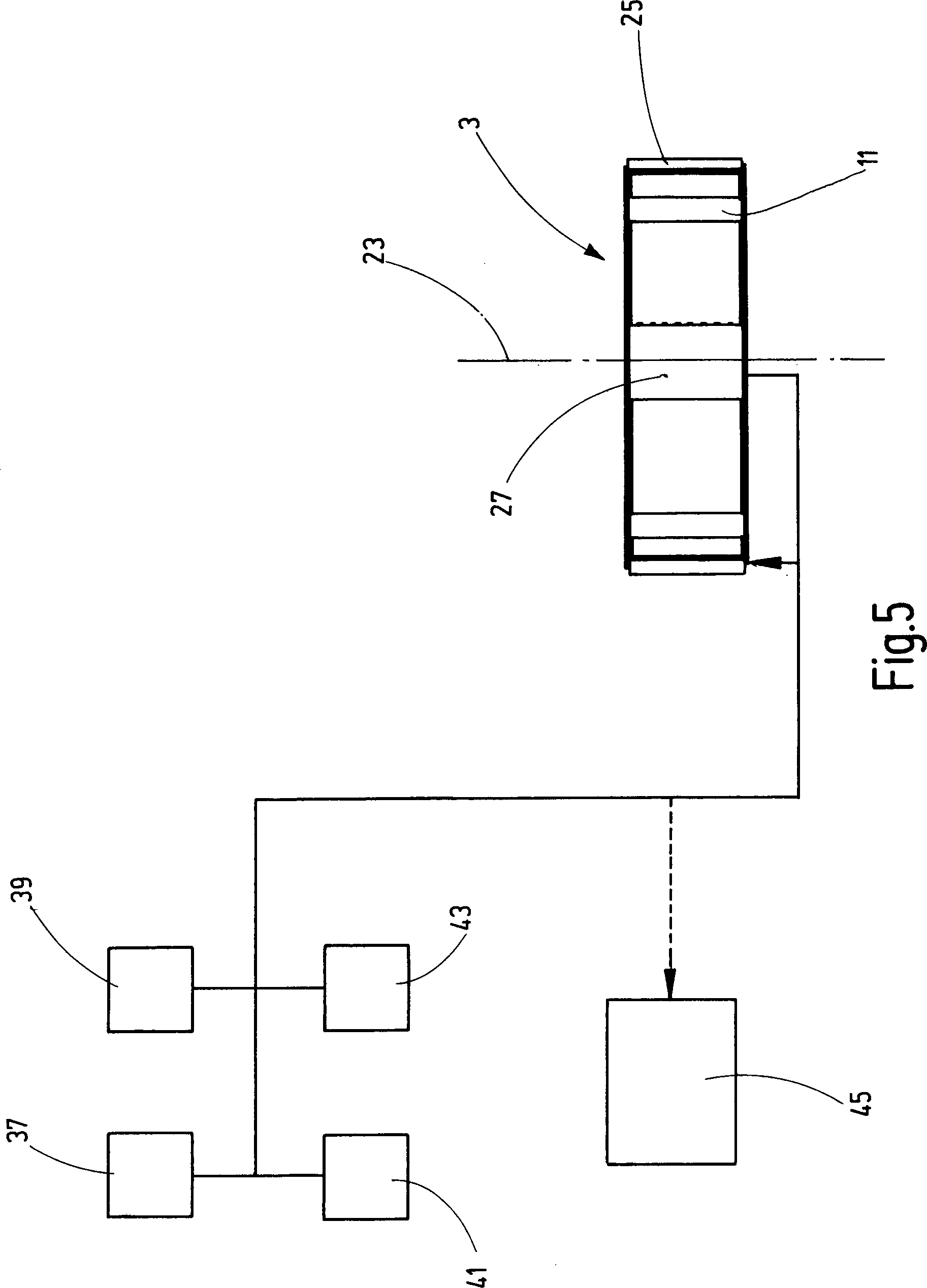Energy converting device e.g. power plant, for converting inertial energy into local mechanical energy, has rotary mass that is movable along path, and drive device coupled with mass, where rotation of drive device enables movement of path
Die
Erfindung betrifft eine Einrichtung zur Wandlung von Inertial-Energie
in lokale mechanische Energie gemäß Oberbegriff
des Anspruchs 1. Einrichtungen
der hier angesprochenen Art sind bekannt ( Aufgabe
der Erfindung ist es daher, eine Einrichtung zur Wandlung von Energie,
kurz: einen Energiewandler, zu schaffen, der die oben genannten Nachteile
vermeidet, insbesondere keine fossilen Brennstoffe benötigt
und Sicherheitsprobleme bei der Endlagerung radioaktiven Mülls
vermeidet. Zur
Lösung dieser Aufgabe wird eine Einrichtung mit mindestens
einer rotierenden Masse vorgeschlagen, der eine Abgabeeinrichtung
zugeordnet ist, an welcher von der Masse aufgenommene lokale mechanische
Energie abgreifbar ist. Diese Energie wird durch Wandlung von Inertial-Energie
gewonnen. Unter dem Begriff „Inertial-Energie" wird hier
Energie verstanden, die innerhalb der Quanten der Materie gebunden
ist (Jω2 = mc2)
und durch Bewegung nach außerhalb fließen und
genutzt werden kann. Die Einrichtung zeichnet sich dadurch aus,
dass die mindestens eine Masse entlang einer Bahn bewegbar ist, und
dass eine Antriebseinrichtung vorgesehen ist, die mit der Masse
koppelbar ist und deren Rotation und Bahnbewegung bewirkt. Der Energiewandler
hat den Vorzug, dass er ein vergleichsweise einfaches technisches
Verfahren ausnutzt, das sich auf bewährte Technologien
stützen kann. Die Nutzung von Kräften durch die
Kombination von linearen und kreisförmigen Bewegungen ist
in Natur und Technik weit verbreitet: Beispielsweise hat die Coriolis-Kraft eine
große Bedeutung für die Entstehung der Passatwinde
(Nordost- und Südost-Passate); der den Magnus-Effekt nutzende
Flettner-Rotor kann Schiffe antreiben, und der Kutta-Joukowski-Effekt
ist essentiell zur Erklärung des Auftriebs von Flugzeugen.
Die hier vorgeschlagene Einrichtung nutzt das Auftreten großer
Coriolis-Beschleunigungen zur Erzeugung großer mechanischer
Kräfte. Bevorzugt
wird eine Einrichtung, die sich dadurch auszeichnet, dass die Abgabeeinrichtung
eine Nabe umfasst, die mit der mindestens einen Masse gekoppelt
ist. Die lokale mechanische Energie kann dann an der Nabe beispielsweise
durch eine in die Nabe eingreifende Welle abgegriffen werden. Auch
wird eine Einrichtung bevorzugt, die sich dadurch auszeichnet, dass
die mindestens eine Masse als Doppelmasse ausgebildet ist. Unter
einer Doppelmasse wird hier eine sich aus zwei Massenelementen zusammensetzende
Masse verstanden. Demnach hat man also zwei Massenelemente, die gemeinsam
die zur Energiewandlung erforderliche Masse bereitstellen. Besonders
bevorzugt wird auch eine Einrichtung, bei der die mindestens eine
Masse als Doppelzylinder ausgebildet ist. In diesem Ausführungsbeispiel
liegt die Masse als Doppelmasse vor, sodass zwei jeweils zylinderförmige
Masseelemente vorgesehen sind, die konzentrisch zueinander angeordnet sind. Bei
einer weiteren bevorzugten Einrichtung ist vorgesehen, dass die
Antriebseinrichtung ein erstes Antriebselement umfasst, das die
mindestens eine Masse in Rotation versetzt. Dies kann beispielsweise
beim Anfahren der Einrichtung geschehen. Vorzugsweise ist vorgesehen,
dass das erste Antriebselement die mindestens eine Masse während des
Betriebs der Maschine auf einer konstanten Winkelgeschwindigkeit
hält. In diesem Fall ist die Drehgeschwindigkeit der Abgabeeinrichtung,
von der die lokale mechanische Energie abgenommen werden kann, konstant.
Es treten also je nach Leistungserzeugung beziehungsweise Leistungsentnahme
unterschiedliche Momente an der Abgabeeinrichtung auf. Bevorzugt
wird auch eine Einrichtung, die sich dadurch auszeichnet, dass die
Antriebseinrichtung ein zweites Antriebselement umfasst, das die Translationsbewegung
der Masse entlang der Bahn bewirkt. Die Masse kann sich somit autonom
entlang der Bahn bewegen, ohne dass eine Kopplung zu einer feststehenden
Mitnehmereinrichtung vorgesehen sein muss. Besonders
bevorzugt wird auch eine Einrichtung, die sich dadurch auszeichnet,
dass das erste Antriebselement als Elektromotor, vorzugsweise als Linearmotor,
ausgebildet ist. Ein Linearmotor ist beispielsweise aus der Transrapid-Technologie
bekannt und zeichnet sich durch einen besonders geringen Verschleiß aus.
Alternativ kann auch das zweite Antriebselement als Elektromotor,
vorzugsweise als Linearmotor, ausgebildet sein. Es können
allerdings auch beide Antriebselemente der Antriebseinrichtung als
Elektromotor, vorzugsweise als Linearmotor, ausgebildet sein. Es
wird auch noch eine Einrichtung bevorzugt, die sich dadurch auszeichnet,
dass das erste Antriebselement von Hilfsmaschinen oder aus dem elektrischen
Leitungsnetz gespeist wird. In diesem Fall bezieht das Antriebselement
seine zum Antrieb nötige Energie also nicht aus einer in
dem Antriebselement vorgesehenen Vorrichtung, sondern aus separaten
Einrichtungen. Alternativ kann auch das zweite Antriebselement von
Hilfsmaschinen oder aus dem elektrischen Leitungsnetz gespeist werden.
Es können auch beide Antriebselemente von Hilfsmaschinen
oder aus dem elektrischen Leitungsnetz gespeist werden. Auch
wird eine Einrichtung bevorzugt, die sich dadurch auszeichnet, dass
ein Akkumulator zur Speicherung elektrischer Energie vorgesehen
ist. Dies bedeutet zum einen eine sehr einfache Maßnahme
zur Bereitstellung von Antriebsenergie, zum anderen kann auch die
von der Einrichtung gelieferte Energie direkt in den Akkumulator
eingespeichert werden. Weiterhin
wird eine Einrichtung bevorzugt, die sich dadurch auszeichnet, dass
der Akkumulator ringförmig ausgebildet ist. Besonders
bevorzugt wird dabei auch eine Einrichtung, bei der der ringförmig
ausgebildete Akkumulator zwischen den Zylindern des Doppelzylinders
angeordnet ist. Dies hat den Vorteil, dass der Akkumulator auf besonders
einfache Weise mit der rotierenden Doppelmasse gelagert werden kann, ohne
gegebenenfalls eine Unwucht zu erzeugen. Es
wird auch eine Einrichtung bevorzugt, bei der der Akkumulator mit
der mindestens einen Masse zusammen rotiert. In diesem Fall kann
der Akkumulator auf besonders einfache Weise mit der Masse verbunden
sein, was sich vor allem konstruktiv als Vorteil erweist. Bei
einer weiteren bevorzugten Einrichtung ist vorgesehen, dass der
Akkumulator mindestens eines der Antriebselemente der Antriebseinrichtung
mit Energie speist. Die entlang der Bahn bewegte Masse führt
in diesem Fall also ihre zum Antrieb erforderliche Energiequelle
mit sich, was ebenfalls einen konstruktiv besonders günstigen
Aufbau gewährleistet. Es
wird auch noch eine Einrichtung bevorzugt, die sich dadurch auszeichnet,
dass die Abgabeeinrichtung mindestens ein Verbindungselement zur Kopplung
der mindestens einen Masse mit der Nabe aufweist. Weiterhin
wird eine Einrichtung bevorzugt, bei dem das mindestens eine Verbindungselement als
mindestens eine Speiche ausgebildet ist. Speichen sind eine besonders
einfache und kostengünstig herzustellende Ausgestaltung
eines Verbindungselementes. Bevorzugt
wird auch eine Einrichtung, bei der die Nabe mit einer Welle verbunden
ist. Die Welle greift dabei die an der Nabe vorliegende gewandelte mechanische
Energie ab und führt sie einem Verbraucher zu. Es ist dabei
prinzipiell gleichgültig, welche Art Verbraucher hier vorgesehen
ist. Es kann sich dabei beispielsweise um einen Generator zur Erzeugung
elektrischer Energie handeln. Es kann sich aber auch um das Getriebe
eines Fahrzeugs, eines Schiffes oder eines Luftfahrzeugs handeln.
Wesentlich ist lediglich, dass die mechanische Energie, die an der
Nabe vorliegt, durch eine Welle abgreifbar ist. Bevorzugt
wird weiterhin eine Einrichtung, die sich dadurch auszeichnet, dass
sich die mindestens eine Masse entlang der Bahn bewegt und dabei eine
konstante Geschwindigkeit aufweist. In diesem Fall tritt also während
der Bahnbewegung der Masse weder eine Beschleunigung noch eine Verzögerung auf. Auch
wird eine Einrichtung bevorzugt, die sich dadurch auszeichnet, dass
die Bahn eine Ringbahn ist. Dies ist zum einen konstruktiv besonders einfach,
zum anderen ist es vorteilhaft für den Platzbedarf der
Bahn, da diese in sich zurückgekrümmt ist. Auch
bevorzugt wird eine Einrichtung, die sich dadurch auszeichnet, dass
die Bahn durch mindestens eine Schiene oder ein Schienensystem definiert
wird. Weiterhin
bevorzugt wird auch eine Einrichtung, bei der vorgesehen ist, dass
es sich bei der Schiene um eine Doppelschiene handelt. Der Vorteil liegt
hierbei in einer präzisen Führung der Einrichtung,
die entweder durch einen mit ihr verbundenen kompakten Motor oder
durch einen beispielsweise mit der Schiene zusammenwirkenden Linearmotor entlang
der Bahn bewegt werden kann. Es
wird auch eine Einrichtung bevorzugt, bei der die Bahn eine Gleitbahn
ist. Bei einer solchen Ausbildung der Bahn können seitens
der Einrichtung Räder entfallen, und die Einrichtung gleitet
in einfacher Weise entlang der Bahn. Auch
wird eine Einrichtung bevorzugt, die sich dadurch auszeichnet, dass
die Bahn der Fahrweg eines Fahrzeugs ist. In diesem Fall ist die
Einrichtung mit dem Fahrzeug verbunden, sodass sie zusammen mit
dem Fahrzeug dem Fahrweg folgt. Darüber hinaus müssen
an den Fahrweg keinerlei weitere Ansprüche gestellt werden,
insbesondere muss es sich nicht um einen kreisförmigen
oder in sich geschlossenen Fahrweg handeln. Auch
bevorzugt wird eine Einrichtung, die sich dadurch auszeichnet, dass
die mindestens eine Masse um eine Achse rotiert, die quer zur Bahn
angeordnet ist, entlang derer die mindestens eine Masse bewegt wird.
Die Ausrichtung der Rotationsachse kann dabei parallel zu einer
Ebene orientiert sein, in der die mindestens eine Masse entlang
ihrer Bahn bewegt wird, sie kann aber auch senkrecht oder in einem
beliebigen Winkel zu dieser Ebene angeordnet sein. Wesentlich ist
nur, dass zumindest eine nicht verschwindende Komponente der horizontalen
Achse vorgesehen ist, die quer zur Bahn angeordnet ist. Da die Corioliskraft
nämlich durch das Kreuzprodukt der linearen Geschwindigkeit
mit der Rotationsgeschwindigkeit gebildet wird, würde sie
verschwinden, wenn beide Geschwindigkeitsvektoren parallel zueinander
ausgerichtet wären. Besonders
bevorzugt wird eine Einrichtung, die sich dadurch auszeichnet, dass
ein Gehäuse vorgesehen ist, in dem die mindestens eine
Masse angeordnet ist, das diese also umgibt und zusammen mit ihr
entlang der Bahn bewegt wird. Das Gehäuse schützt
hierbei auf vorteilhafte Weise die Masse vor Umwelteinflüssen
oder Schmutz. Auch
wird eine Einrichtung bevorzugt, bei der das Gehäuse, das
die Masse umgibt und mit dieser entlang der Bahn bewegt wird, evakuiert
ist. Bei hinreichend gutem Vakuum umfasst der Raum, in dem die Masse
rotiert, nur noch vernachlässigbar wenige Gasmoleküle,
sodass der Widerstand, dem die rotierende Masse ausgesetzt ist,
deutlich verringert ist. Auch
bevorzugt wird eine Einrichtung, die sich dadurch auszeichnet, dass
die Bahn, entlang der die mindestens eine Masse bewegt wird, in
einem Gehäuse angeordnet ist. Eine solche Anordnung schützt auf
vorteilhafte Weise nicht nur die bewegliche Masse, sondern auch
die gesamte Bahn. Es
wird auch eine Einrichtung bevorzugt, die sich dadurch auszeichnet,
dass das Gehäuse evakuiert ist, in dem sich die Bahn befindet,
entlang der die mindestens eine Masse bewegt wird. Auf diese Weise
ist also nicht nur die Rotation der Masse einem geringeren Widerstand
unterworfen, sondern auch die Translationsbewegung. In
diesem Zusammenhang wird auch eine Einrichtung bevorzugt, bei der
innerhalb eines Gehäuses, in dem sich die Bahn befindet,
entlang der die mindestens eine Masse bewegt wird, ein weiteres Gehäuse
vorgesehen ist, dass die Masse umgibt und sich zusammen mit der
Masse entlang der Bahn bewegt. Beide Gehäuse können
dabei evakuiert sein. Es kann auch vorgesehen sein, dass das innere
Gehäuse eine Öffnung enthält, sodass
inneres und äußeres Gehäuse zwei Pumpstufen
desselben Vakuumrezipienten darstellen. Die Druckdifferenz zwischen
den beiden Pumpstufen des Rezipienten ist dann über die
Wahl des Durchmessers der Öffnung im Inneren Gehäuse
einstellbar. Weiterhin
wird eine Einrichtung bevorzugt, die sich dadurch auszeichnet, dass
der mindestens einen Masse eine weitere Masse zugeordnet ist, die um
dieselbe gedachte Achse rotiert wie die erste, jedoch mit entgegengesetztem
Drehsinn. Aus diesem Grund wird die weitere Masse im Folgenden auch
als Gegendrehmasse bezeichnet. Beide Massen sind gemeinsam auf derselben
gedachten Achse angeordnet und werden zusammen entlang der Bahn
bewegt. Sie bilden auf diese Weise eine Doppeldrehmasse. Auch
wird eine Einrichtung bevorzugt, bei der mehrere Massen entlang
derselben Bahn bewegt werden. Vorzugsweise können auch
mehrere Doppeldrehmassen entlang derselben Bahn bewegt werden. Es
wird aber auch eine Einrichtung bevorzugt, bei der sowohl mehrere
Massen als auch mehrere Doppeldrehmassen entlang derselben Bahn
bewegt werden. Auf diese Weise kann man auf derselben Bahn nahezu
beliebig viele Abgabeeinrichtungen für mechanische Energie
vorsehen, und so die Effizienz eines solchen Energiewandlers beträchtlich
steigern. Besonders
bevorzugt wird auch eine Einrichtung, die sich dadurch auszeichnet,
dass die Bahn eine Ringbahn ist, und die umlaufenden rotierenden Massen
und/oder Doppeldrehmassen im gleichen Winkelabstand auf dieser angeordnet
sind. Es wird so eine regelmäßige Anordnung erzielt.
Sollte die Translationsbewegung einer Masse oder Doppeldrehmasse
aufgrund eines technischen Defekts ausfallen, so ist die Reaktionszeit
zum Anhalten der übrigen Massen in diesem Fall gleich lang,
unabhängig davon, welche Masse bezüglich ihrer
Translationsbewegung ausfällt. Eine
weitere bevorzugte Einrichtung zeichnet sich dadurch aus, dass sie
in beliebiger Größe auslegbar ist. Dies bedeutet,
dass die Einrichtung beispielsweise als kleines Tischgerät
zum Aufladen eines tragbaren elektronischen Geräts, oder
auch als großtechnische Anlage zur Energiewandlung in industriellem
Maßstab ausgebildet sein kann. In
diesem Zusammenhang wird besonders eine Einrichtung bevorzugt, die
sich dadurch auszeichnet, dass sie als Kraftwerk ausgelegt ist. Es
wird auch noch eine Einrichtung bevorzugt, die sich dadurch auszeichnet,
dass sie mit einem Generator gekoppelt ist, so dass die von der Einrichtung
abgegebene mechanische Energie zumindest teilweise von dem Generator
in elektrische Energie gewandelt werden kann. In
diesem Zusammenhang wird besonders eine Einrichtung bevorzugt, die
als Gebäudeheizung ausgelegt ist. Es kann beispielsweise
eine elektrische Gebäudeheizung von einem mit der Einrichtung gekoppelten
Generator mit elektrischer Energie versorgt werden. Schließlich
wird noch eine Einrichtung bevorzugt, die so ausgelegt ist, dass
sie als Energieverstärker verwendbar ist. In diesem Fall
wird für den Antrieb der rotierenden und translatierenden
Masse Energie aus externen Einrichtungen herangezogen, die von der
Einrichtung im Betrieb zurückgewonnen und vermehrt wird.
Die so vermehrte Energie wird über die Abgabeeinrichtung
an einen Verbraucher weitergegeben. Es wird also die von den externen Einrichtungen
entnommene Energie verstärkt. Die
Erfindung wird im Folgenden anhand der Zeichnung näher
erläutert. Es zeigen: Die
Energiewandlung funktioniert nach folgendem Prinzip: Die mit der
Einrichtung 3 verbundene rotierende Masse weist eine Umfangsgeschwindigkeit
v1 auf, die gegeben ist durch das Produkt
ihres Radius r1 und ihrer Winkelgeschwindigkeit ω1. Die rotierende Masse wird zusammen mit
der Einrichtung 3 entlang der Bahn 5 mit einer
Geschwindigkeit v2 bewegt. Es bilden sich
daher die folgenden Energien aus. Die eine Halbmasse der rotierenden
Masse M hat die Energie während die andere
Halbmasse die kleinere Energie aufweist. Multipliziert man
die binomischen Formeln in den Geschwindigkeiten aus, so erhält
man im Fall für die Werte Subtrahiert
man nun den zweiten Ausdruck vom ersten, so erhält man Multipliziert
man diesen Wert mit der zu berücksichtigenden Masse M/4,
dann erhält man die hier so genannte actio-Energie, die
einen Beitrag leistet zur Erhaltung und Vergrößerung
der Trägheitsenergie also in Richtung der Bahn 5 auf
die Masse M wirkt. Die actio-Energie leistet weiterhin einen Beitrag
zur Rotationsenergie die quer zur Bewegungsrichtung
der rotierenden Masse M auf die Bahn 5 wirkt, die Masse
also bezüglich ihrer Rotation antreibt. JM ist
hier das Trägheitsmoment der rotierenden Masse M. Im Gleichgewichtszustand
halten sich actio-Energie und die der Antriebseinrichtung entnommene
Energie einerseits sowie Verluste infolge von Reibung und Luftwiderstand
andererseits die Waage. Die Wirkungsweise der Einrichtung als Energiewandler
basiert auf der Nutzung des Satzes von Steiner, der besagt, dass der
Drehimpuls einer rotierenden Masse sich im Verhältnis des
Quadrates der beiden Radien r1 der Masse
einerseits und rN einer Nabe, an der die
gewandelte Energie abgreifbar ist, vergrößert.
Für die hier relevanten Trägheitsmomente gilt Damit
wird erreicht, dass an der Nabe zum Antrieb einer beliebigen Maschine
eine erheblich größere Kraft zur Verfügung
steht als direkt an der Masse. Ist das Verhältnis der Radien
r1/rN = 10, dann wächst
das Massenträgheitsmoment JN an
der Nabe um den Faktor 101 gegenüber dem Massenträgheitsmoment
JM direkt an der Masse. Es ist daher möglich, die
auf die Masse M wirkende Corioliskraft entsprechend zu verstärken
und zur Energieerzeugung einzusetzen. Die so erzeugte Energie wird
hier inertiale Energie genannt, da sie aus den unterschiedlichen inertialen
Energien der beiden Hälften der rotierenden Masse M stammt,
die sich gleichzeitig quasi linear auf der Bahn 5 bewegt.
Die Energieerhaltung wird dabei nicht verletzt. Es wird also in
keiner Weise aus der Einrichtung mehr Energie entnommen, als in
sie hineinfließt. Die Einrichtung ist mit der sich inertial entlang
ihrer Bahn bewegenden und um sich selbst drehenden Erde über
deren Schwerefeld gekoppelt. Dies führt dazu, die Nutzenergie
der praktisch unerschöpflichen Bewegungsenergie der Erde
entnehmen zu können. Die Geschwindigkeiten v1 und
v2 sind nämlich Anteile der Bahngeschwindigkeit
der Erde sowie ihrer Rotationsgeschwindigkeit. Die Grundlage des
Energietransfers ergibt sich aus der quantenmechanischen Beschreibung
der Zusammenhänge. Die
Einrichtung 3 umfasst eine Masse 11, die beispielsweise
als Doppelmasse ausgebildet sein kann. Unter einer Doppelmasse wird
hier eine sich aus zwei Massenelementen zusammensetzende Masse verstanden.
Demnach hat man also zwei Massenelemente, die gemeinsam die zur
Energiewandlung erforderliche Masse bereitstellen. Die
Einrichtung 3 umfasst hier eine ringförmig ausgebildete
Masse 11. Sie ist gebildet aus einem Zylinder aus schwerem
Metall. Nicht dargestellt ist hier, dass die Masse 11 auch
als Doppelzylinder ausgebildet werden kann, wobei die beiden Zylinder des
Doppelzylinders konzentrisch zueinander angeordnet sind, sodass
sich ein zylinderförmiger Spalt in umfänglicher
Richtung zwischen den beiden Zylindern ergibt, in den beispielsweise
ein hier ebenfalls nicht dargestellter Akkumulator eingebracht werden kann.
Der Akkumulator ist zur Speicherung von elektrischer Energie vorgesehen,
die beispielsweise mindestens eines der beiden Antriebselemente
der Antriebseinrichtung speisen kann, die die Rotation der Masse 11 beziehungsweise
die Translation der Einrichtung 3 entlang der Bahn 5 bewirken.
Andererseits kann in den Akkumulator auch Energie eingespeist werden,
die an der Einrichtung 3 anfällt und an einen Generator
abgegeben werden kann. Der
Masse 11 kann auch eine hier nicht dargestellte weitere
Masse oder Doppelmasse zugeordnet sein, die um dieselbe Achse rotiert
wie die Masse 11, jedoch mit entgegengesetztem Drehsinn.
Diese weitere Masse wird daher als Gegendrehmasse bezeichnet. Beide
Massen sind auf derselben gedachten Achse angeordnet – konzentrisch
oder auch axial zueinander versetzt – und werden zusammen entlang
der Bahn 5 bewegt. Sie werden als Doppeldrehmasse bezeichnet. Es
können auch mehrere Massen 11 und/oder Doppeldrehmassen
entlang derselben Bahn 5 bewegt werden. Diese können
beispielsweise gleiche Abstände (oder Winkelabstände,
wenn die Bahn 5 eine Ringbahn ist) zueinander aufweisen,
so dass eine regelmäßige Anordnung erzielt wird. Die
Einrichtung 3 umfasst eine Abgabeeinrichtung, die wiederum
eine Nabe 13 und beispielhaft Speichen 15, 17, 19 und 21 umfasst.
Die Masse 11 ist mit der Nabe 13 über
die Speichen 15, 17, 19 und 21 gekoppelt.
Es sind auch andere Arten von Verbindungselementen zwischen der
Masse 11 und der Nabe 13 denkbar, wie beispielsweise
ein geschlossenes Rad. Außerdem ist auch die Anzahl der
Speichen hier beispielhaft zu vier gewählt. Es können
auch lediglich eine Speiche oder beliebig viele Speichen vorgesehen
sein. Die Nabe 13 der Abgabeeinrichtung kann mit einer
hier nicht dargestellten Welle verbunden sein, um die von der Einrichtung 3 bereitgestellte Nutzenergie
an einen Verbraucher abgeben zu können. Dieser Verbraucher
kann beispielsweise ein Generator zur Erzeugung elektrischer Energie
aber auch ein Antrieb für Fahrzeuge, Schiffe oder Luftfahrzeuge
sein. Auch jeder andere Verbraucher von mechanischer Energie ist
denkbar. Die mit Hilfe eines Generators gewonnene elektrische Energie
kann auch beispielsweise einer elektrischen Heizung zugeführt
werden. Auf diese Weise kann die Anlage 1 beziehungsweise
die Einrichtung 3 zu Heizzwecken verwendet werden. Im
Zentrum der Einrichtung 3 befindet sich eine Rotationsachse 23,
um die die Ringmasse 11 rotiert. Auch bei diesem Ausführungsbeispiel
ist die Ringmasse 11 vorzugsweise als Doppelzylinder ausgebildet,
wobei in dem von den beiden konzentrisch angeordneten Zylindern
freigelassenen zylindrischen Zwischenraum ein Akkumulator angeordnet
ist. Dieser Akkumulator kann vorzugsweise mit der Masse 11 zusammen
rotieren. Im Umfangsbereich der Einrichtung 3 ist beispielsweise
ein Linearmotor 25 angeordnet, der ein erstes Antriebselement
einer Antriebseinrichtung der Einrichtung 3 darstellt und
die Rotation der Masse 11 bewirkt. Anstelle des Linearmotors 25 ist
auch jedes andere Antriebselement einsetzbar, das geeignet ist,
eine Rotation der Masse 11 zu bewirken. Weiterhin ist es
auch möglich, die Masse 11 im Start der Einrichtung 3 von
einer externen Einrichtung in Rotation zu versetzen, sodass dann ein
entsprechend kleiner dimensioniertes Antriebselement vorgesehen
sein kann, das im Betrieb der Einrichtung 3 die Rotation
der Masse 11 gegen Reibungsverluste aufrechterhält.
Andererseits wird die Einrichtung 3, sobald sie entlang
der Bahn 5 bewegt wird, beginnen, Energie zu liefern, die
ebenfalls in der Lage ist, die Rotation der Masse 11 aufrechtzuerhalten.
Insofern wäre es auch möglich, ganz auf ein Antriebselement
zu verzichten, und einen Teil der Nutzenergie der Einrichtung 3 für
die Aufrechterhaltung der Rotation der Masse 11 zu verwenden.
Bevorzugt wird allerdings ein Ausführungsbeispiel, bei
dem ein erstes Antriebselement die Masse 11 mit einer konstanten
Winkelgeschwindigkeit rotieren lässt. In diesem Fall ist
eine Regelung vorgesehen, die auf unterschiedliche Betriebsbedingungen
reagiert. Je nach von der Einrichtung 3 bereitgestellter
Nutzenergie oder von einem externen Verbraucher angeforderter Leistung
werden von der Regelung dann die an der Abgabeeinrichtung auftretenden
Momente so variiert, dass die Winkelgeschwindigkeit der Masse 11 konstant
gehalten werden kann. Der
Linearmotor 25 oder das anders ausgebildete erste Antriebselement
beziehungsweise die Antriebseinrichtung als Ganzes kann die zum
Antrieb erforderliche Energie beispielsweise aus dem Akkumulator
beziehen. Sie kann aber auch von Hilfsmaschinen oder aus dem elektrischen
Netz gespeist werden. Ist
ein anderer als ein elektrischer Antrieb vorgesehen, so muss auch
eine andere Art der Energieversorgung gewährleistet sein.
Rein beispielhaft kann ein Tank vorgesehen sein, der vorzugsweise ebenfalls
ringförmig ausgebildet ist und flüssigen oder
gasförmigen Brennstoff für eine entsprechende als
Antriebseinrichtung dienende Brennkraftmaschine enthält. Im
oberen Bereich des Zentrums der Einrichtung 3 ist bei dem
hier dargestellten Ausführungsbeispiel ein Generator 27 vorgesehen,
der die an der Abgabeeinrichtung zur Verfügung gestellte
mechanische Energie zumindest teilweise in elektrische Energie umwandelt.
Diese elektrische Energie kann einem Verbraucher – beispielsweise
einer elektrischen (Gebäude-)Heizung – zur Verfügung
gestellt werden, oder direkt in den Akkumulator, der mit der Einrichtung 3 verbunden
ist, eingespeist werden. Es kann auch ein Teil der Energie in den
Akkumulator eingespeist werden, während ein anderer Teil
einem externen Verbraucher zur Verfügung gestellt wird. Im
unteren Bereich der Einrichtung 3 ist ein zweites Antriebselement 29 erkennbar,
das eine Translationsbewegung der Einrichtung 3 in Richtung des
Doppelpfeils 31 bewirkt. Auf diese Weise folgt die Einrichtung 3 einer
Bahn 5. Besonders bevorzugt wird ein Ausführungsbeispiel,
bei dem das Antriebselement 29 die Einrichtung 3 mit
einer konstanten Geschwindigkeit in Richtung des Doppelpfeils 31 entlang
einer hier nicht dargestellten Bahn 5 bewegt. Das Antriebselement 29 kann
prinzipiell ein beliebig ausgestalteter Motor sein; vorzugsweise
wird ein Elektromotor eingesetzt. Dieser kann die zum Antrieb nötige
Energie direkt aus dem Akkumulator der Einrichtung 3 beziehen.
Er kann aber auch von Hilfsmaschinen oder aus dem elektrischen Leitungsnetz
gespeist werden. Besonders
bevorzugt wird eine Ausgestaltung des Antriebselements 29 als
Linearmotor, wobei ein Teil des Antriebselements entlang der hier
nicht dargestellten Bahn 5 angeordnet ist. Je nach Ausgestaltung
der Bahn 5 kommen unterschiedliche Fortbewegungsmittel
an der Einrichtung 3 zum Einsatz. Rein beispielhaft sind
hier Räder 33 und 35 gezeigt, die beispielsweise
zur Fortbewegung entlang einer herkömmlichen Straße
dienen können. Es können aber auch Räder
vorgesehen sein, wie man sie von Schienenfahrzeugen kennt. Dies
würde einer Fortbewegung der Einrichtung 3 auf
einer Schiene oder auf einer Doppelschiene entsprechen. Weiterhin
kann ein Gleitlager vorgesehen sein, wenn die Bahn 5 als Gleitbahn
ausgestaltet ist. Auch jede andere Form einer Fortbewegungseinrichtung
ist im Zusammenhang mit einer entsprechend ausgestalteten Bahn 5 denkbar. Die
Einrichtung 3 kann ein nicht dargestelltes Gehäuse
umfassen, in dem die Masse 11 rotiert, das als Schutz vor
Umwelteinflüssen und Schmutz dient. Das Gehäuse
kann auch die gesamte Einrichtung 3 umgeben. Dabei ist
es möglich, das Gehäuse zu evakuieren, um den Luftwiderstand,
der der Rotation der Masse 11 entgegenwirkt, zu verringern. Es
kann auch ein Gehäuse vorgesehen sein, das die gesamte
Bahn 5 zusammen mit der Einrichtung 3 umfasst.
Auch dieses Gehäuse kann evakuiert werden, wodurch zusätzlich
der Luftwiderstand verringert wird, der der Bahnbewegung der Einrichtung 3 entgegenwirkt. Selbstverständlich
können auch zwei Gehäuse vorgesehen sein, von
denen das erste die Einrichtung 3 umfasst und dabei selbst
von dem zweiten umgeben wird, das auch die Bahn 5 einschließt.
Es können dabei je eines der Gehäuse oder auch
beide evakuiert sein. Letzteres kann durch separate Pumpen für
jedes Gehäuse realisiert werden, oder aber durch eine Öffnung
in der Wandung des inneren Gehäuses, so dass zwei Pumpstufen
innerhalb des gleichen Vakuumrezipienten entstehen. In diesem Fall
ist nur eine Pumpeinrichtung vorgesehen, die das äußere
Gehäuse evakuiert, während das innere Gehäuse mittelbar über
seine Öffnung evakuiert wird. Das Verhältnis der
sich in den beiden Pumpstufen einstellenden Druckwerte ist dann
abhängig von der Größe der Öffnung
des inneren Gehäuses. Das
hier dargestellte Ausführungsbeispiel unterscheidet sich
von dem in Die
Ausgestaltung der Einrichtung 3 entspricht dem Ausführungsbeispiel,
das in In
dem hier angesprochenen Ausführungsbeispiel wird die Bahn 5 ersetzt
durch den Fahrweg des Fahrzeugs, mit dem die Einrichtung 3 verbunden ist.
Befindet sich das Fahrzeug in Bewegung, liefert die Einrichtung 3 Nutzenergie,
die dem Fahrzeugantrieb zur Verfügung gestellt werden kann.
Bei dem Antrieb kann es sich wahlweise um einen herkömmlichen
zentralen Antrieb handeln, bei dem die Welle eines Getriebes in
die Nabe der Abgabeeinrichtung der Einrichtung 3 eingreift.
Es kann sich aber auch um einen Elektroantrieb handeln, dem die
im Generator 27 erzeugte elektrische Energie zur Verfügung gestellt
wird. Besonders
vorteilhaft ist eine Ausgestaltung als elektrischer Allradantrieb,
bei dem jedem einzelnen Rad jeweils ein eigener Elektromotor 37, 39, 41 und 43 zugeordnet
ist. Es ist jedoch auch eine zentrale elektrische Antriebseinheit 45 denkbar.
Prinzipiell ist jede Antriebsart denkbar, die Energie von der Abgabeeinrichtung
der Einrichtung 3 abnimmt. Die
Funktionsweise des Fahrzeugs ist die Folgende: Zunächst
entnimmt der vorzugsweise Elektromotoren nutzende Antrieb des Fahrzeugs elektrische
Energie aus dem nicht dargestellten Akkumulator, um den Vortrieb
des Fahrzeugs zu bewirken. Gleichzeitig wird die Masse 11 von
dem Linearmotor 25, der sich ebenfalls aus dem Akkumulator speist,
in Rotation versetzt. Ist das Fahrzeug erst einmal entlang seines
Fahrweges in Bewegung – wobei der Fahrweg hier die Bahn 5 ersetzt –,
liefert die Einrichtung 3 Nutzenergie, die zum einen dazu
verwendet werden kann, die Rotation der Masse 11 und die Fortbewegung
des Fahrzeugs entlang seines Fahrwegs anzutreiben, zum anderen den
Akkumulator wieder aufzuladen. Unabhängig
von den hier dargestellten Ausführungsbeispielen kann die
Einrichtung 3 prinzipiell in beliebiger Größe
ausgelegt werden. Das ermöglicht, sie als kleines Tischgerät
zu dimensionieren, beispielsweise zum Betreiben tragbarer elektronischer
Geräte, oder auch als großtechnische Anlage, beispielsweise
als Kraftwerk. Die
Einrichtung 3 kann auch als Energieverstärker
eingesetzt werden, wobei für die Antriebseinrichtung Energie
aus externen Quellen herangezogen wird, die von der Einrichtung 3 im
Betrieb zurückgewonnen und vermehrt wird. Diese vermehrte
Energie kann an einen Verbraucher weitergegeben werden. Insofern
wird die den externen Quellen entnommene Energie verstärkt. Insgesamt
zeigt sich, dass mit der hier vorgeschlagenen Einrichtung ein Energiewandler
zur Verfügung steht, der Energie aus einer auf menschlicher Zeitskala
unerschöpflichen Energiequelle in lokale mechanische Energie
wandelt und dabei keinerlei negative Auswirkungen auf die Umwelt
verursacht. Zugleich ist die Technik mit keinerlei Risiko verbunden.
Besonders vorteilhaft ist auch, dass die Energiewandlung mit einem
vergleichsweise einfachen technischen Verfahren bewirkt wird, das
sich auf bewährte Technologien stützen kann. Die
von der vorgeschlagenen Einrichtung zur Verfügung gestellte
Nutzenergie speist sich aus der inertialen Bewegungsenergie der
Erde und wird dadurch nutzbar, dass die Einrichtung mit der Erde über
deren Schwerefeld gekoppelt ist. Durch
die überlagerte Rotations- und Translationsbewegung treten
Corioliskräfte auf, die in der Natur eine große
Rolle spielen. Diese Corioliskräfte wirken auf die in der
Einrichtung rotierende Masse und treiben diese bezüglich
ihrer Rotation und bezüglich ihrer Translation an. Die
gewonnene Energie wird dabei der Bewegungsenergie der Erde entnommen. Die
Bahnbewegungsenergie der Erde liegt nämlich bei 2,65 × 1033 Joule. Demgegenüber betrug der
Energieverbrauch in Deutschland im Jahre 2001 1,45 × 1019 Joule. Würde man also nur 0,1%
der Bahnbewegungsenergie der Erde verbrauchen, dann würde diese
Energie in Deutschland für über hundert Milliarden
Jahre den Bedarf abdecken. Umgerechnet auf den weltweiten Energiebedarf
ergäben sich immerhin noch einige Milliarden Jahre. Zur
Veranschaulichung der Energie, die man mit einer vergleichsweise
kleinen Einrichtung gewinnen kann, mag das folgende Rechenbeispiel
dienen: Während die Coriolis-Beschleunigung der Erde 2,18 ms–2 beträgt, ist die Beschleunigung
einer mit 30 Hz rotierenden Masse, die mit 108 km/h = 30 ms–1 linear bewegt wird, 9425 ms–2, also das 4323fache. Die dabei
entstehende Energie ist für eine Masse von 50 kg und einem
Kreisdurchmesser von 1 m rund 222 kJ. Aus diesem Grund kann die
Nutzung der Coriolis-Kraft zur Energiegewinnung als besonders aussichtsreich
gelten. Diese Liste
der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert
erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information
des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen
Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt
keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen. The device (3) has a rotary mass for receiving local mechanical energy, where the rotary mass is formed as a double cylinder. A transfer device measures the local mechanical energy. The rotary mass is movable along a path (5) i.e. ring path. A drive device is coupled with the rotary mass, where rotation of the drive device enables movement of the path. The transfer device comprises a hub coupled with the rotary mass. The drive device comprises a drive component i.e. linear motor, that rotates the rotary mass at a constant angular speed. Einrichtung (3) zur Wandlung von Inertial-Energie
in lokale mechanische Energie mit Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die Abgabeeinrichtung eine mit der mindestens einen Masse (11)
gekoppelte Nabe (13) umfasst. Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
dass die mindestens eine Masse (11) als Doppelmasse ausgebildet
ist. Einrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,
dass die mindestens eine Masse (11) als Doppelzylinder
ausgebildet ist, dessen Zylinder konzentrisch zueinander angeordnet
sind. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Antriebseinrichtung ein erstes
Antriebselement umfasst, das die mindestens eine Masse (11)
in Rotation versetzt und vorzugsweise im Betrieb auf einer konstanten
Winkelgeschwindigkeit hält. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Antriebseinrichtung ein zweites
Antriebselement (29) umfasst, das die Translationsbewegung
der Masse (11) entlang der Bahn (5) bewirkt. Einrichtung nach Anspruch 5 und/oder 6, dadurch gekennzeichnet,
dass das erste und/oder das zweite Antriebselement als Elektromotor,
vorzugsweise als Linearmotor (25), ausgebildet sind. Einrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass das erste und/oder das zweite Antriebselement
von Hilfsmaschinen oder aus dem elektrischen Leitungsnetz gespeist
werden. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass ein Akkumulator zur Speicherung elektrischer
Energie vorgesehen ist. Einrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet,
dass der Akkumulator ringförmig ausgebildet und vorzugsweise
zwischen den Zylindern des Doppelzylinders angeordnet ist. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Akkumulator mit der mindestens
einen Masse (11) zusammen rotiert. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Akkumulator mindestens eines der
Antriebselemente der Antriebseinrichtung mit Energie speist. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Abgabeeinrichtung mindestens ein
Verbindungselement, vorzugsweise mindestens eine Speiche (15, 17, 19, 21; 15', 17', 19'),
zur Kopplung der mindestens einen Masse (11) mit der Nabe
(13) aufweist. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Nabe (13) mit einer Welle
verbunden ist. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass sich die mindestens eine Masse (11)
mit konstanter Geschwindigkeit entlang der Bahn (5) bewegt. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Bahn (5) eine Ringbahn
ist. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Bahn (5) durch mindestens
eine Schiene oder ein Schienensystem, vorzugsweise eine Doppelschiene,
definiert wird. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Bahn (5) eine Gleitbahn
ist. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Bahn (5) der Fahrweg eines
Fahrzeugs ist, mit dem die Einrichtung (3) verbunden ist. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine Masse (11)
um eine Achse (23) rotiert, die quer zur Bahn (5)
angeordnet ist, entlang derer die mindestens eine Masse (11)
bewegt wird. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine Masse (11)
in einem Gehäuse angeordnet ist, das die Masse (11)
umgibt und mit der Masse (11) entlang der Bahn (5)
bewegt wird. Einrichtung nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet,
dass das Gehäuse evakuiert ist, so dass die mindestens
eine Masse (11) bezüglich ihrer Rotation einem
verringerten Widerstand unterliegt. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Bahn (5), entlang der
die mindestens eine Masse (11) bewegt wird, in einem Gehäuse
angeordnet ist. Einrichtung nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet,
dass das Gehäuse evakuiert ist, so dass die mindestens
Masse (11) sowohl bezüglich ihrer Rotation als
auch bezüglich ihrer Bahnbewegung einem verringerten Widerstand
unterliegt. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens einen Masse (11)
eine Gegendrehmasse zugeordnet ist, und dass beide in entgegengesetztem Drehsinn
um dieselbe gedachte Achse (23) rotieren und damit eine
Doppeldrehmasse bilden. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Massen (11) und/oder
Doppeldrehmassen entlang derselben Bahn (5) bewegt werden. Einrichtung nach Anspruch 26, dadurch gekennzeichnet,
dass die Bahn (5) eine Ringbahn ist, und die umlaufenden
rotierenden Massen (11) und/oder Doppeldrehmassen in gleichen
Winkelabständen auf dieser verteilt sind. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Einrichtung (3) in beliebiger
Größe auslegbar ist. Einrichtung nach Anspruch 28, dadurch gekennzeichnet,
dass die Einrichtung (3) als Kraftwerk ausgelegt ist. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Einrichtung (3) mit einem
Generator (27) koppelbar ist, der die mechanische Energie
in elektrische Energie wandelt. Einrichtung nach den Ansprüchen 28 und
30, dadurch gekennzeichnet, dass die Einrichtung (3) als Gebäudeheizung
ausgelegt ist. Einrichtung nach einem der einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Einrichtung
(3) als Energieverstärker verwendbar ist.ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
Zitierte Patentliteratur
– mindestens einer
rotierenden Masse (11) zur Aufnahme der lokalen mechanischen
Energie, und
– einer Abgabeeinrichtung, mittels derer
die lokale mechanische Energie abgreifbar ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass
– die mindestens eine Masse (11) entlang
einer Bahn (5) bewegbar ist, und
– eine Antriebseinrichtung
vorgesehen ist, die mit der mindestens einen Masse (11)
koppelbar ist und deren Rotation und Bahnbewegung bewirkt.