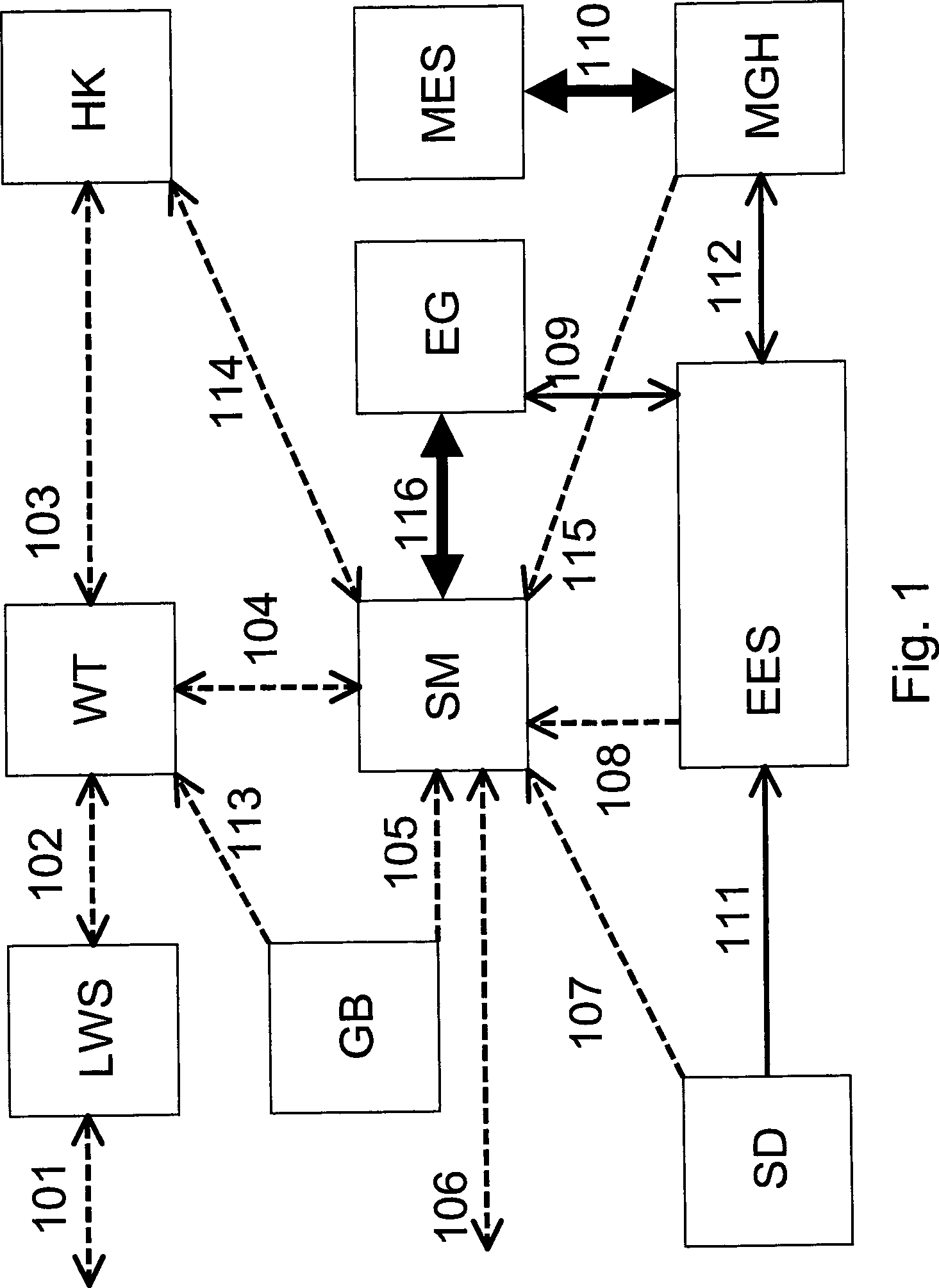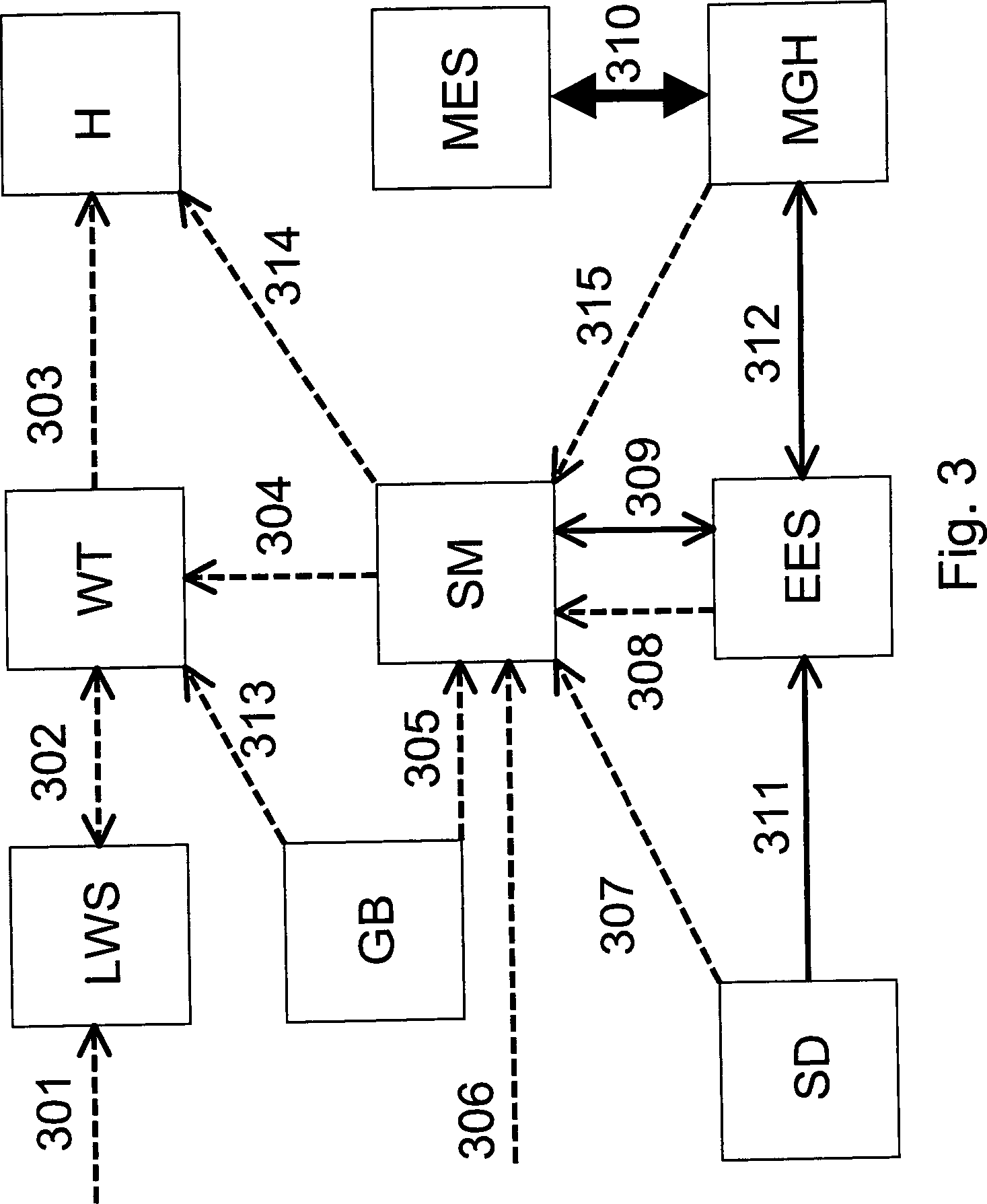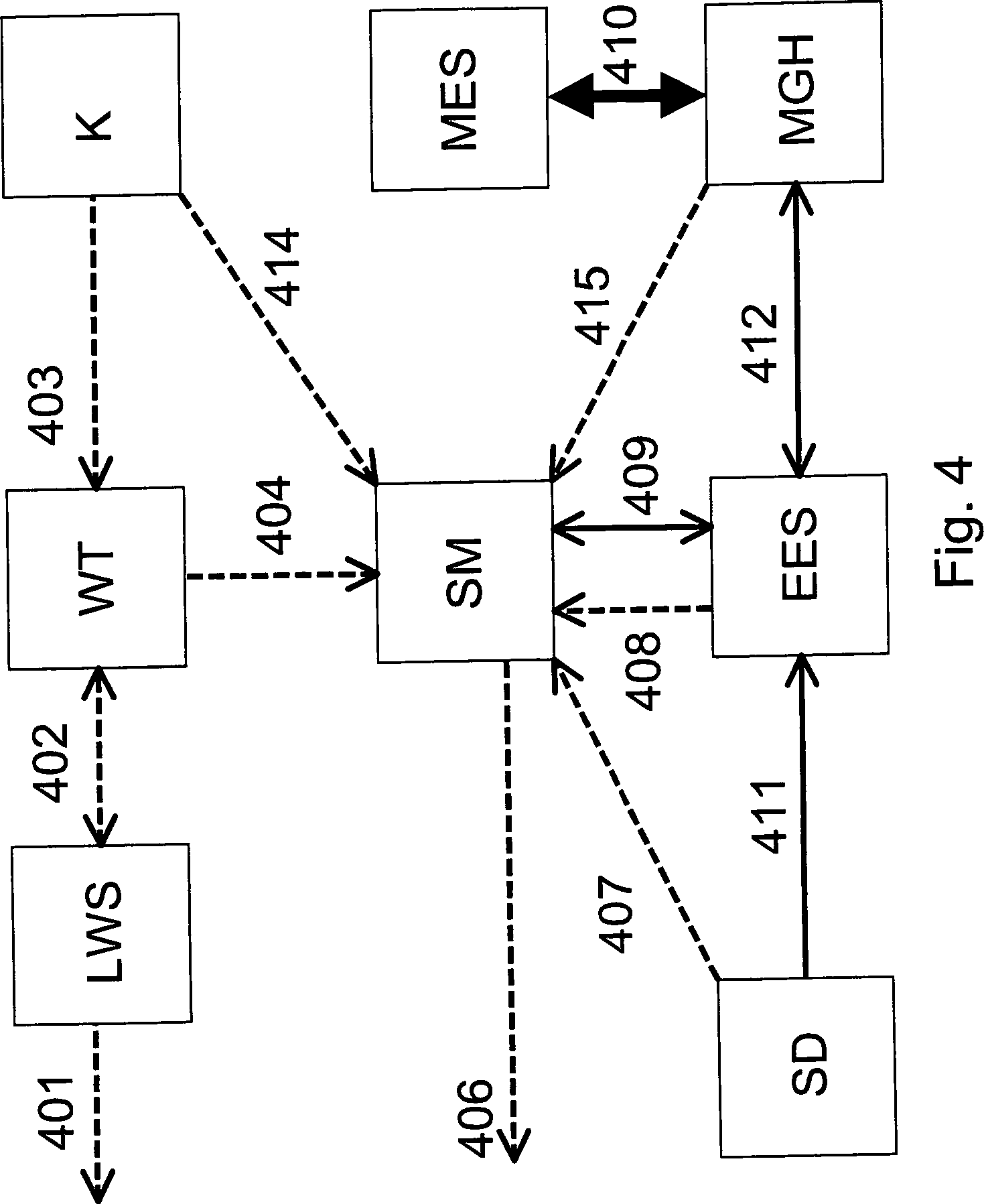Arrangement and method for supplying power to motorized vehicles
Die
Erfindung betrifft eine Anordnung und ein Verfahren zur Energieversorgung
motorisierter Fahrzeuge. Die
Schonung der Weltenergiereserven und ein sparsamer Umgang mit Energie
ist heute in allen Bereichen des täglichen Lebens und seiner technischen
Unterstützung
aus ökologischen
und ökonomischen
Gründen
ein wichtiges Ziel. Wegen der großen Verbreitung motorisierter
Fahrzeuge, ihrer großen Bedeutung
für unsere
Mobilität
und der damit verbundenen beträchtlichen
Energieumsätze
ist der schonende und sparsame Einsatz von Energie gerade bei motorisierten
Fahrzeugen von besonderer Bedeutung. Dies
zeigt sich insbesondere auch bei Elektrofahrzeugen. Die noch geringe
spezifische Ladekapazität
heute verfügbarer
Batterien zur Speicherung elektrischer Energie begrenzt beispielsweise
die Reichweite von Elektrofahrzeugen und ist ein Grund für die geringe
Verbreitung dieser Fahrzeuge. Klimatisierung und Heizung eines elektrisch
betriebenen Fahrzeugs sind nur begrenzt möglich, weil damit eine weitere
wesentliche Beschränkung
der Reichweite verbunden wäre.
Der Markt für
Elektrofahrzeuge, die nicht den gewohnten Insassenkomfort bieten,
ist heute noch ohne Bedeutung. Angesichts der Tatsache, dass die
Preise für
Kraftstoffe in den nächsten Jahren
weiter steigen werden, ist dennoch davon auszugehen, dass Elektrofahrzeuge
bereits in den nächsten
zehn Jahren einen nennenswerten Marktanteil erreichen werden, wenn
praktikable Losungen für
die Beheizung und Klimatisierung und damit ein akzeptabler Insassenkomfort
angeboten werden. Der
vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Anordnung
und ein Verfahren zur Energieversorgung motorisierter Fahrzeuge
anzugeben, die diese Zielsetzung mit fortschrittlichen technischen
Konzepten unterstützt.
Diese Aufgabe wird durch eine Anordnung und durch ein Verfahren
nach einem der unabhängigen
Ansprüche
gelöst. Die
Erfindung sieht eine Anordnung und ein Verfahren zur Energieversorgung
motorisierter Fahrzeuge vor, bei der eine Wärmekraftmaschine die im Fahrzeug
anfallende Wärme
wenigstens teilweise in Bewegungsenergie des Fahrzeugs umwandelt
und andere Teile dieser Wärme
einem Wärmespeicher zuführt. Im
Zusammenhang mit der Beschreibung der vorliegenden Erfindung verwendete
Begriffe werden im Folgenden definiert und erläutert. Unter
einem motorisierten Fahrzeug im Sinne der vorliegenden Erfindung
sollen Fahrzeuge aller Art verstanden werden, die ihre Bewegungsenergie wenigstens
teilweise aus einem Motor beziehen, der einer (sogenannten) Energiequelle
(die wegen des Energieerhaltungssatzes physikalisch korrekt eigentlich
als Energiespeicher zu bezeichnen wäre) Energie entnimmt und diese
wenigstens teilweise in Bewegungsenergie des Fahrzeugs umwandelt.
Typische Beispiele solcher motorisierten Fahrzeuge sind unter anderem
Kraftfahrzeuge für
den Straßenverkehr,
Lokomotiven, Schiffe und Flugzeuge. Als Motoren kommen insbesondere
aber nicht ausschließlich Verbrennungsmotoren,
Elektromotoren und Kombinationen aus solchen Antriebsaggregaten,
sogenannte Hybridantriebe, in Betracht. Unter
einer Wärmekraftmaschine
im Sinne der vorliegenden Erfindung ist eine Einrichtung zur wenigstens
teilweisen Umwandlung von Wärme,
also mikroskopischer Bewegungsenenergie, in makroskopische Bewegungsenergie
oder in potentielle Energie zu verstehen, die Energie auch in umgekehrter Richtung umwandeln
kann, die also potentielle Energie oder makroskopische Bewegungsenergie
dazu verwendet, auf einem niederen Temperaturniveau anfallende Wärme auf
einem höheren
Temperaturniveau verfügbar
zu machen. Wegen der allgemein bekannten Gesetze der Thermodynamik
kann dies in der ersten Richtung nur teilweise gelingen; in der
anderen Richtung ist makroskopische Energie, beispielsweise die
in einem Kondensator gespeicherte potentielle elektrische Energie
oder Teile der Bewegungsenergie eines Fahrzeugs, aufzuwenden, um Wärme auf
ein höheres
Temperaturniveau zu pumpen. Die
vorliegende Erfindung macht sich die Existenz solcher Wärmekraftmaschinen
zunutze und ist nicht auf einen bestimmten Typus solcher Wärmekraftmaschinen
beschränkt.
Ein wichtiges Beispiel für eine
solche Wärmekraftmaschine
bildet die Klasse von Wärmekraftmaschinen,
die allgemein als Stirling Motoren bezeichnet werden. Diese Maschinen
haben den Vorteil, dass sie von der Wahl eines speziellen Prozesses
für die
Wärmeerzeugung
weitgehend unabhängig
sind und deshalb mit Wärmereservoirs und
Wärmequellen
der unterschiedlichsten Art realisiert werden können. Die Erfindung ist jedoch
nicht auf Stirling Motoren oder andere bekannte Wärmekraftmaschinen
beschränkt;
sie kann grundsätzlich auch
mit noch zu entwickelnden Wärmekraftmaschinen
realisiert werden. Unter
im Fahrzeug anfallender Wärme
im Sinne der vorliegenden Erfindung soll jede Art von Wärme verstanden
werden, die im oder am Fahrzeug anfällt. Dabei kann es sich insbesondere
um Verlustwärme,
also um die Abwärme
jeder Art von Energieverbrauchern oder Energiewandlern im Fahrzeug handeln,
aber auch um Wärme,
die durch eine Thermalisierung einfallender Strahlung entsteht,
also insbesondere durch die Aufheizung des Fahrzeuginnenraums, der
Fahrzeugoberflächen
oder auf den Oberflächen
angebrachter Kollektoren. Unter
einem Wärmespeicher
im Sinne der vorliegenden Erfindung soll jede Einrichtung verstanden
werden, die Wärmeenergie
aufnehmen, speichern und bei Bedarf wieder abgeben kann. Insbesondere
kann es sich um sogenannte Latentwärmespeicher handeln, die auf
dem Prinzip der latenten Wärme
eines Phasenübergangs,
meistens eines Phasenübergangs
erster Ordnung, basieren. Einem ähnlichen
Prinzip folgt die Ausnutzung der Enthalpie reversibler chemischer
Reaktionen, so z. B. von auf Chemisorption beruhenden Absorptions-
und Desorptionsprozessen. Das geschieht in sogenannten thermochemischen
Wärmespeichern,
die eine noch höhere
Energiedichte ermöglichen. Unter
der Bewegungsenergie (kinetischer Energie) des Fahrzeugs im Sinne
der vorliegenden Erfindung soll jede Form von makroskopischer Bewegungsenergie
verstanden werden, die dem Fahrzeug entnommen werden könnte. Dazu
gehören
insbesondere die Bewegungsenergie des Fahrzeugs im engeren Sinne,
also alle Formen der Bewegungsenergie, die der Bewegung des Fahrzeugs
im Raum zuzuordnen sind, im weiteren Sinne aber auch solche Formen
der Bewegungsenergie, die mit der Bewegung von Fahrzeugteilen (Motor,
Räder,
etc.) zusammenhängen.
Unter makroskopischer Energie ist dabei jede Form von Energie zu
verstehen, die nicht mit der Anregung mikroskopischer (insbesondere
molekularer) Freiheitsgrade verbunden ist, und die daher im Prinzip – also ohne
Verletzung thermodynamischer Grundgesetze – vollständig in andere makroskopische
Energieformen umgewandelt werden kann. Unter
einem mechanischen Energiespeicher im Sinne der vorliegenden Erfindung
soll jede Form eines Energiespeichers verstanden werden, in dem Energie
in mechanischer Weise, also durch Anregung makroskopischer Freiheitsgrade,
wie insbesondere der Rotation, der Vibration oder der reversiblen, beispielsweise
elastischen, Deformation makroskopischer Körper reversibel gespeichert
werden kann. Wichtige Beispiele für solche Speicher sind Schwungräder oder
Torsionsfederspeicher. Alle mechanischen Energiespeicher können makroskopische
Bewegungsenergie reversibel in der Form makroskopischer Bewegungs- oder potentieller
Energie ohne Umwandlung in andere, beispielsweise chemische oder
elektrische Energieformen speichern. Unter
einem elektrochemischen Energiespeicher im Sinne der vorliegenden
Erfindung sollen alle Formen sogenannter galvanischer Zellen verstanden
werden. Diese werden umgangssprachlich häufig als Batterien oder Akkumulatoren
bezeichnet; sie speichern elektrische Energie in chemischer Form
und geben sie bei Bedarf wieder in Form elektrischer Energie ab.
Wichtige Beispiele sind Lithium-Ionen-Batterien. Diese und einige
andere elektrochemische Energiespeicher zeichnen sich durch einen
hohen Grad an Reversibilität
aus. Vorteilhafte
Weiterbildungen der Erfindung bilden den Gegenstand von Unteransprüchen. Im
Folgenden wird die Erfindung anhand bevorzugter Ausführungsbeispiele
und mit Hilfe von Figuren näher
beschrieben. Dabei zeigt Wie
in Wärmekraftmaschinen
nutzen ”rechtslaufende” Kreisprozesse,
bei denen die geschlossene Kurve etwa im T-S oder p-v-Diagramm im
Sinne ”oben nach
rechts, unten nach links” durchlaufen
wird. Wärmepumpen
nutzen ”linkslaufende” Kreisprozesse. Ein
wichtiges Beispiel für
eine Wärmekraftmaschine ist
neben dem in Straßenfahrzeugen
sehr verbreiteten Verbrennungsmotor die Stirling-Maschine, die als Stirling-Motor
bezeichnet wird. Der
Stirlingmotor ist eine Wärmekraftmaschine,
in der ein abgeschlossenes Arbeitsgas wie Luft oder Helium von außen an zwei
verschiedenen Bereichen abwechselnd erhitzt und gekühlt wird,
um mechanische Energie zu erzeugen. Der Stirlingmotor arbeitet nach
dem Prinzip eines geschlossenen Kreisprozesses und ist ein Beispiel
für die
Energieumwandlung von einer schlecht nutzbaren Energieform (thermische
Energie, Wärmeenergie,
mikroskopische Bewegungsenergie) in die besser einsetzbare Energieform
der mechanischen Energie. Der Stirlingmotor kann mit einer beliebigen
externen Wärme-(oder
Kälte)quelle
betrieben werden. Es gibt Modelle, die bereits bei Anfassen durch
die Wärme
der menschlichen Hand in Gang kommen. Als
Arbeitsmedium wird bei einigen Stirling-Motoren Helium eingesetzt.
Dieses wird in einem geschlossenen Kreislauf zyklisch von zwei Kolben (Arbeits-
und Verdrängerkolben)
zwischen einer heißen
Stelle (Erhitzer) und einer kalten Stelle (Kühler) hin- und hergeschoben.
Das aufgeheizte Gas dehnt sich aus, das abgekühlte zieht sich zusammen. Hierdurch
steigt der Druck im Helium. Dieser Gasdruck wirkt über den
Arbeitskolben auf den Kurbeltrieb. Die mechanische Energie kann
durch Elektrogeneratoren in elektrische Energie umgewandelt werden.
Diese Elektrogeneratoren können
auch als Elektromotoren arbeiten, und in dieser Betriebsart die
Stirling-Maschine antreiben, die dann als Wärmepumpe arbeiten kann. Zwischen
dem Erhitzerkopf und dem Kühler befindet
sich der Regenerator, der dem Gas auf seinem Weg von der heißen zur
kalten Seite Wärme
entzieht und beim Rückströmen wieder
zuführt. Gemäß dem in Das
in In
sämtlichen
Figuren bezeichnen Pfeile mit gestrichelten Linien 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 113, 114, 115, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 213, 214, 215, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314, 315, 401, 402, 403, 404, 406, 407, 408, 414, 415, 501, 502, 504, 505, 506, 507, 508, 513, 515 einen
Austausch von Wärme,
während
Pfeile mit durchgezogenen Linien einen Austausch makroskopischer
(„mechanischer”) Bewegungsenergie
oder elektrischer Energie bezeichnen. Dabei bezeichnen Pfeile 109, 209, 309, 409, 509, 112, 212, 312, 412, 512 mit
dünneren
durchgezogenen Linien den Austausch elektrischer Energie, wogegen
Pfeile 110, 116, 210, 216, 217, 310, 410, 510 mit
dickeren durchgezogenen Linien den Austausch mechanischer Energie
bezeichnen. So bezeichnet beispielsweise der Doppelpfeil 116 in Der
elektrische Generator EG kann dabei direkt oder über ein Getriebe mechanisch
an die Wärmekraftmaschine
SM gekoppelt sein. In ähnlicher Weise
bezeichnet der Doppelpfeil 110 in Der
Wärmeaustausch 102, 104 zwischen
der Wärmekraftmaschine
SM und dem Wärmespeicher LBS
findet vorzugsweise über
einen Wärmetauscher WT
statt. Der vorzugsweise auch dazu dient, den Wärmeübergang 103 zwischen
der Heizung bzw. Klimaanlage HK oder den Wärmeübergang 113 zwischen
dem Gasbrenner GB und dem Wärmespeicher LWS
zu vermitteln. Dem Wärmespeicher
LWS, der vorzugsweise als Latentwärmespeicher ausgelegt ist,
kann auch von außen
Wärme zugeführt oder
entnommen werden 101. Die Wärmekraftmaschine SM kann auch
von dem Gasbrenner GB direkt Wärme 105 übernehmen
oder es kann der Wärmekraftmaschine
SM Wärme
von außen 106 zugeführt oder
ihr entnommen werden. Auch
die Stoßdämpfer SD
können
ihre Abwärme 107 der
Wärmekraftmaschine
SM zur Verfügung
stellen, wie auch der elektrische Energiespeicher EES seine Abwärme 108 der
Wärmekraftmaschine
SM nutzbar machen kann. Vorzugsweise wird auch die Abwärme des
Fahrzeugmotors MGH der Wärmekraftmaschine
SM zugeführt 115.
Vorzugsweise wird auch die Restwärme
der Heizung bzw. Klimaanlage HK der Wärmekraftmaschine SM zur Verfügung gestellt 114 bzw.
wird die Wärme
der Wärmekraftmaschine
SM der Heizung bzw. Klimaanlage HK zugeführt 114. Die So
zeigt Bei
einer anderen Betriebsart der erfindungsgemäßen Anordnung, die in In
Abhängigkeit
von der gewählten
Ausführungsform
der erfindungsgemäßen Anordnung
und der gewählten
Betriebsart dieser Anordnung lässt sich
die Verlustwärme – insbesondere
die Abwärmen 107, 108 oder 115 – verschiedener
Komponenten der Anordnung – insbesondere
der Stoßdämpfer SD,
des elektrischen Energiespeichers EES oder des Hauptantriebs MGH,
sehr weitgehend nutzen und geht folglich nicht verloren. Beispiele
für solche
nutzbaren Wärmemengen
ergeben sich beim Laden und beim Betrieb des elektrochemischen Energiespeichers EES
(Batterie) sowie beim Betrieb des Antriebsmotors bzw. Generators
MGH. Aber auch den Stoßdämpfern SD
kann beispielsweise während
der Fahrt Wärmeenergie 507 oder
elektrische Energie 511 entnommen werden. Zu diesem Zweck
können
die Stoßdämpfer beispielsweise
mit Linear-Generatoren
ausgestattet werden, mit deren Hilfe die Bewegungsenergie des Fahrzeugs,
in diesem Fall handelt es sich um Schwingungsenergie, wenigstens
teilweise in elektrische Energie umgewandelt und so einer Nutzung
zugeführt 111, 211, 311, 411, 511 werden
kann. Diese Art der Energieumwandlung und Nutzung kann alternativ
oder ergänzend
zur Nutzung der Verlustwärme
aus den Stoßdämpfern durchgeführt werden. Zur
Nutzung der Verlustwärme
können
die Stoßdämpfer mit
einem geeigneten Kühlsystemen
ausgestattet sein. Bevorzugte
Ausführungsbeispiele
der vorliegenden Erfindung ermöglichen
ferner eine Nutzung der Wärme,
die durch ein Aufheizen der Karosserie bei Sonneneinstrahlung entsteht.
Größere Flachen der
Karosserie – insbesondere
das Fahrzeugdach – sind
erfindungsgemäß vorzugsweise
als Leichtbau-Verbundstruktur
ausgeführt.
Im Kontakt mit der Außenfläche stehen
beispielsweise mit einer Kühlflüssigkeit
durchströmte
Kanäle.
Die Kühlflüssigkeit transportiert
bei diesen Ausführungsbeispielen
der Erfindung die durch Sonneneinstrahlung erzeugte Wärme vorzugsweise
nach dem Prinzip eines Sonnenkollektors ab 106, 206, 306, 406, 506 und
führt sie
der Wärmekraftmaschine
zu. Bevorzugte
Ausführungsbeispiele
der vorliegenden Erfindung sehen den Einsatz eines Wärmespeichers
LWS, vorzugsweise eines Latentwärmespeichers
im Fahrzeug vor, der vor Antritt der Fahrt durch elektrischen Strom
aus dem Versorgungsnetz oder während
der Fahrt durch die beschriebenen Verlustwärmeströme aufgeheizt 101, 201, 301, 401, 501 werden
kann. Ein
Latentwärmespeicher
ist eine Einrichtung, die thermische Energie „verborgen” (latent vom Lateinischen
latere = verborgen sein, deshalb auch die Bezeichnung Latente Wärme), verlustarm,
mit vielen Wiederholzyklen und über
lange Zeit zu speichern in der Lage ist. Man nutzt beispielsweise
sogenannte Phase change materials (PCM, „Phasenübergangsmaterialien”), deren
latente Schmelzwärme, Lösungswärme oder
Absorptionswärme
wesentlich größer als
die spezifische Wärmekapazität der gleichen
Menge eines Stoffes ohne Phasenumwandlung ist. Beispiele sind Wärmekissen,
Kühlakkus
oder mit Paraffin gefüllte
Speicherelemente in den Tanks von solarthermischen Anlagen. Latentwärmespeicher funktionieren
durch die Ausnutzung der Enthalpie reversibler thermodynamischer
Zustandsänderungen eines
Speichermediums, wie z. B. des Phasenübergangs fest-flüssig (Schmelzen/Erstarren).
Die Ausnutzung des Phasenübergangs
fest-flüssig
ist dabei das am häufigsten
genutzte Prinzip. Beim Aufladen des Inhalts kommerzieller Latentwärmespeicher
werden meist spezielle Salze oder Paraffine als Speichermedium geschmolzen,
die dazu sehr viel Wärmeenergie,
die Schmelzwärme,
aufnehmen. Da dieser Vorgang reversibel ist, gibt das Speichermedium genau
diese Wärmemenge
beim Erstarren wieder ab. Der
Wärmetransport 102, 202, 302, 402, 502 in
den Speicher LWS kann während
der Fahrt mittels einer Wärmekraftmaschine
SM, vorzugsweise einer Stirling-Maschine, die durch einen Elektromotor
EG angetrieben wird, erfolgen. Diese Betriebsweise wird vorzugsweise
dann gewählt,
wenn größere Wärmemengen
als benötigt
zur Verfugung stehen, oder wenn andere Energiemengen, die – beispielsweise bei
einer Talfahrt des Fahrzeugs – aus
der Rückgewinnung
von Bewegungsenergie des Fahrzeugs – beispielsweise durch Umwandlung
von Bremsenergie – zur
Verfügung
stehen und nicht benötigt
werden. Die gespeicherte Wärmeenergie
kann (ohne Betrieb der Stirling-Maschine) direkt zur Beheizung 103, 203, 303, 403 des
Fahrzeugs eingesetzt werden, oder sie wird in der Stirling-Maschine
teilweise in mechanische Wellenarbeit umgewandelt 104, 204, 304, 404, 504.
Damit wird der nun als Generator wirkende Elektromotor EG angetrieben. Mit
dem erzeugten Strom wird bei Bedarf die Batterie EES geladen. Der
besondere Vorteil der Stirling-Maschine besteht darin, dass sie
sowohl für
die Heizung H als auch Kühlung
K des Fahrzeugs oder von Fahrzeugkomponenten und zudem noch für Antriebszwecke 116, 216, 217,
oder zum Laden 109, 209, 309, 409, 509 der
Batterie eingesetzt werden kann. Bevorzugte
Ausführungsbeispiele
der vorliegenden Erfindung sehen den Einsatz eines mechanischen
Energiespeichers MES, vorzugsweise eines getriebelosen Torsinns-Federspeichers
in Leichtbauweise vor, der vorzugsweise über ein Kupplungs-System direkt
mit der Antriebswelle des Elektromotors MGH verbunden 110, 210, 310, 410, 510 ist. Die
Rückgewinnung
von ”Bremsenergie” mittels
des Antriebsmotors MGH, der auch als Generator wirken kann, ist
aufgrund der Wirkungsgradkette mit Verlusten in der Größenordnung
von 35% verbunden. Ein mechanischer Energiespeicher arbeitet fast verlustfrei.
Er wird vorzugsweise über
ein System von Kupplungen direkt mit der Antriebswelle verbunden. Das
Kupplungssystem ist vorzugsweise so gestaltet, dass die Leistungsaufnahme
und -abgabe bei gleicher Drehrichtung erfolgen kann. Derartige Federsysteme
sind geeignet, beispielsweise die kinetische Energie eines Fahrzeugs
mit 1000 kg Gesamtmasse, das mit 50 km/h fährt, aufzunehmen und wieder
abzugeben. Der Federspeicher mit Kupplungssystem wird vorzugsweise
als Leichtbau-Konstruktion ausgeführt. Eine typische Gesamtmasse
eines derartigen Systems beträgt
für die
genannten Auslegungsdaten etwa 40 kg. Eine
bevorzugte Ausführungsform
der Erfindung umfasst einen wärmeisolierten
Latentwärmespeicher
LWS mit einer Betriebstemperatur von etwa 500°C mit einem elektrisch betriebenen
Heizgerät zum
Aufheizen 101, 201, 301, 401, 501 des
Speichers vor Antritt der Fahrt. Vorzugsweise wird ein geregelter
Wärmetauscher
WT zur Wärmeübertragung 103, 203, 303, 403 an
den Kühl-/Heizmittelkreislauf des
Fahrzeugs eingesetzt. Es
gibt vorzugsweise einen zentralen Kühl-/Heizmittelkreislauf HK
des Fahrzeugs, der in geeigneter Weise geregelt ist. Die Wärmekraftmaschine
ist vorzugsweise eine Stirling-Maschine mit einem Arbeitsbereich
zwischen etwa 5°C
(„Kalter Kopf”) und 500°C („Heißer Kopf”). Die
Wärmekraftmaschine
SM, vorzugsweise eine Stirling-Maschine SM, kann während der
Fahrt oder im Stillstand sowohl zur Klimatisierung K als auch zur
Heizung H des Fahrzeugs eingesetzt werden. Die Köpfe der Maschine sind vorzugsweise
wie folgt ausgeführt: Gemäß einiger
bevorzugter Ausführungsformen
der Erfindung ist der Motor/Generator EG oder MGH über eine
Welle 216, 210, 217 mit der Wärmekraftmaschine
SM, vorzugsweise einer Stirling-Maschine verbunden. Die Wärmekraftmschineaschine SM
nimmt mechanische Leistung auf, wenn sie als Wärmepumpe zur Heizung H oder
Klimatisierung K des Fahrzeugs arbeitet; sie gibt mechanische Leistung
ab, wenn sie zwischen dem Temperaturniveau des Wärmespeichers WS und der Umgebungstemperatur
arbeitet. Gemäß einiger
bevorzugter Ausführungsformen
der Erfindung dient ein Gasbrenner GB, vorzugsweise ein gekapselter
Porenbrenner oder ein anderer geeigneter Brenner, z. B. mit Flüssiggas
betrieben, optional als zusätzliche
Wärmequelle
für die Wärmekraftmaschine
SM. Das Flüssiggas
kann als ”letzte
Reserve” bei
entladenem Gesamtsystem dienen. Mit der Wärmekraftmaschine SM und dem
Generator EG kann damit elektrischer Strom zur Aufladung 109, 209 der
Batterie EES erzeugt werden. Mit dieser Funktionalität handelt
es sich dann um ein Hybrid-System. Gemäß einiger
bevorzugter Ausführungsformen
der Erfindung sind die Stoßdämpfer SD
mit Lineargeneratoren ausgestattet. Beispielsweise über einen
Wandler wird ein Gleichstrom 111, 211, 311, 411, 511 erzeugt,
der zur Aufladung der Batterie eingesetzt wird. Alternativ oder
zusätzlich
könnten
die Stoßdämpfer SD
an den Heiz-/Kühlkreislauf
HK des Fahrzeugs angeschlossen werden, um die Verlustwarme direkt
zu nutzen. Gemäß einiger
bevorzugter Ausführungsformen
der Erfindung wird ein mechanischer Energiespeicher MES, vorzugsweise
ein getriebeloser Torsions-Federspeicher, über ein
Kupplungs-System direkt mit der Antriebswelle des Elektromotors
verbunden 110, 210, 310, 410, 510. Das
optimale Zusammenwirken aller oder einiger Komponenten der erfindungsgemäßen Anordnung
wird vorzugsweise durch eine geeignete Regeleinrichtung gewährleistet. Vom
Generator EG erzeugter Strom kann mittels eines elektrischen Widerstands
in Wärme
umgewandelt und für
Heizzwecke oder einer Wärmespeicher
zugeführt
werden. Zur Energieversorgung motorisierter Fahrzeuge ist eine Wärmekraftmaschine (SM) vorgesehen, die im Fahrzeug anfallende Wärme (106, 107, 108, 114) wenigstens teilweise in Bewegungsenergie des Fahrzeugs umwandelt und andere Teile dieser Verlustwärme einem Wärmespeicher (LWS) zuführt. Ein optionaler mechanischer Energiespeicher (MES) kann Bewegungsenergie von einem Fahrzeugmotor (MGH) abnehmen, diese Energie speichern und sie bei Bedarf wieder an einen Fahrzeugmotor (MGH) abgeben. Anordnung zur Energieversorgung motorisierter
Fahrzeuge, Anordnung nach Anspruch 1, bei der das Fahrzeug zumindest
auch von einem Elektromotor (MGH) angetrieben wird, und bei der
die Wärmekraftmaschine
(SM) einen elektrischen Generator (EG) antreibt, wobei die von diesem
Generator erzeugte elektrische Energie (109) wenigstens
teilweise für
den elektrischen Antrieb des Fahrzeugs verwendet wird. Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei
der ein mechanischer Energiespeicher (MES) vorgesehen ist, der so
eingerichtet ist, dass er Bewegungsenergie von einem Fahrzeugmotor
(MGH) abnehmen, diese Energie speichern und sie bei Bedarf wieder
an einen Fahrzeugmotor (MGH) abgeben kann. Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche mit
einem elektrochemischen Energiespeicher (EES), der so eingerichtet
ist, dass er elektrische Energie von einem Fahrzeugmotor (MGH) oder
von der Wärmekraftmaschine
(SM) abnehmen, diese Energie speichern und sie bei Bedarf wieder
an einen Fahrzeugmotor (MGH) oder an die Wärmekraftmaschine (SM) abgeben
kann. Verfahren zur Energieversorgung motorisierter Fahrzeuge, Verfahren nach Anspruch 1, bei dem das Fahrzeug zumindest
auch von einem Elektromotor (MGH) angetrieben wird, und bei der
die Wärmekraftmaschine
(SM) einen elektrischen Generator (EG) antreibt, wobei die von diesem
Generator erzeugte elektrische Energie (109) wenigstens
teilweise für
den elektrischen Antrieb des Fahrzeugs verwendet wird. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei
dem ein mechanischer Energiespeicher (MES) dazu verwendet wird,
Bewegungsenergie von einem Fahrzeugmotor (MGH) abzunehmen, diese
Energie zu speichern und sie bei Bedarf wieder an einen Fahrzeugmotor
(MGH) abzugeben. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche mit
einem elektrochemischen Energiespeicher (EES), der elektrische Energie
von einem Fahrzeugmotor (MGH) oder von der Wärmekraftmaschine (SM) abnehmen,
diese Energie speichern und sie bei Bedarf wieder an einen Fahrzeugmotor (MGH)
oder an die Wärmekraftmaschine
(SM) abgeben kann.
Der „Kalte
Kopf” ist
vorzugsweise als ein geregelter Wärmetauscher zur Wärmeaufnahme 103, 203, 403 von
Kühl-/Heizmittel
ausgestaltet. Der „Heiße Kopf” umfasst
vorzugsweise zwei geregelte Wärmetauscher.
Der erste dient zur Wärmeabgabe 103, 203, 303 an
Kühl-/Heizmittel
des Fahrzeugs bei maximal 100°C,
der zweite dient zur Wärmeabgabe 102, 202, 302, 402, 502 an
ein geeignetes Fluid, das den Latentwärmespeicher bis 500°C aufheizt.
Der erste und der zweite Wärmetauscher
werden vorzugsweise durch ein motorbetriebenes Dreiwege-Ventil umgeschaltet.
dadurch gekennzeichnet, dass
– eine Wärmekraftmaschine
(SM) vorgesehen ist, die im Fahrzeug anfallende Wärme (106, 107, 108, 114) wenigstens
teilweise in Bewegungsenergie des Fahrzeugs umwandelt und andere
Teile dieser Wärme
einem Wärmespeicher
(LWS) zuführt.
dadurch
gekennzeichnet, dass
– eine
Wärmekraftmaschine
(SM) im Fahrzeug anfallende Wärme
(106, 107, 108, 114) wenigstens
teilweise in Bewegungsenergie des Fahrzeugs umwandelt und andere
Teile dieser Wärme
einem Wärmespeicher
(LWS) zuführt.