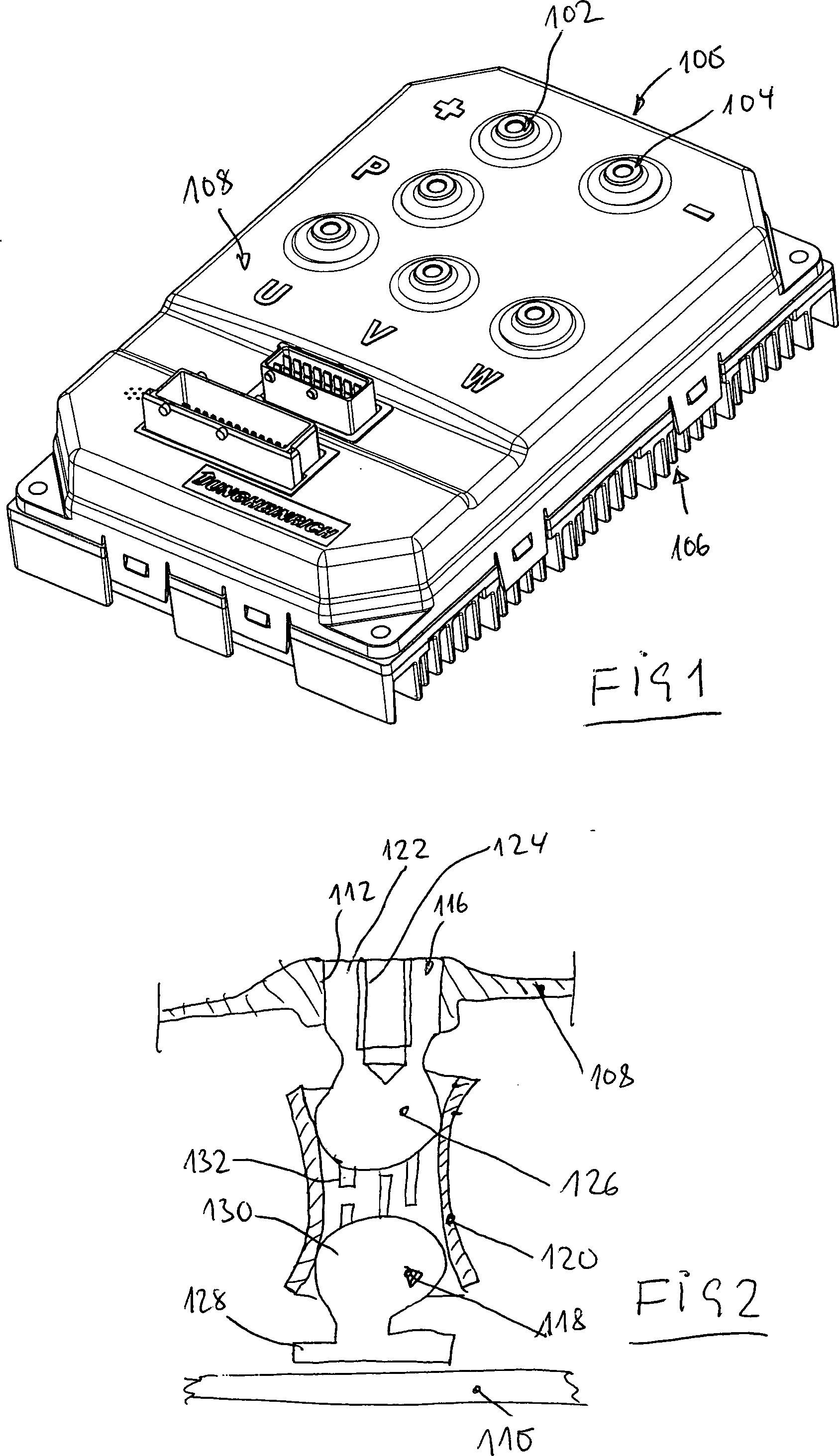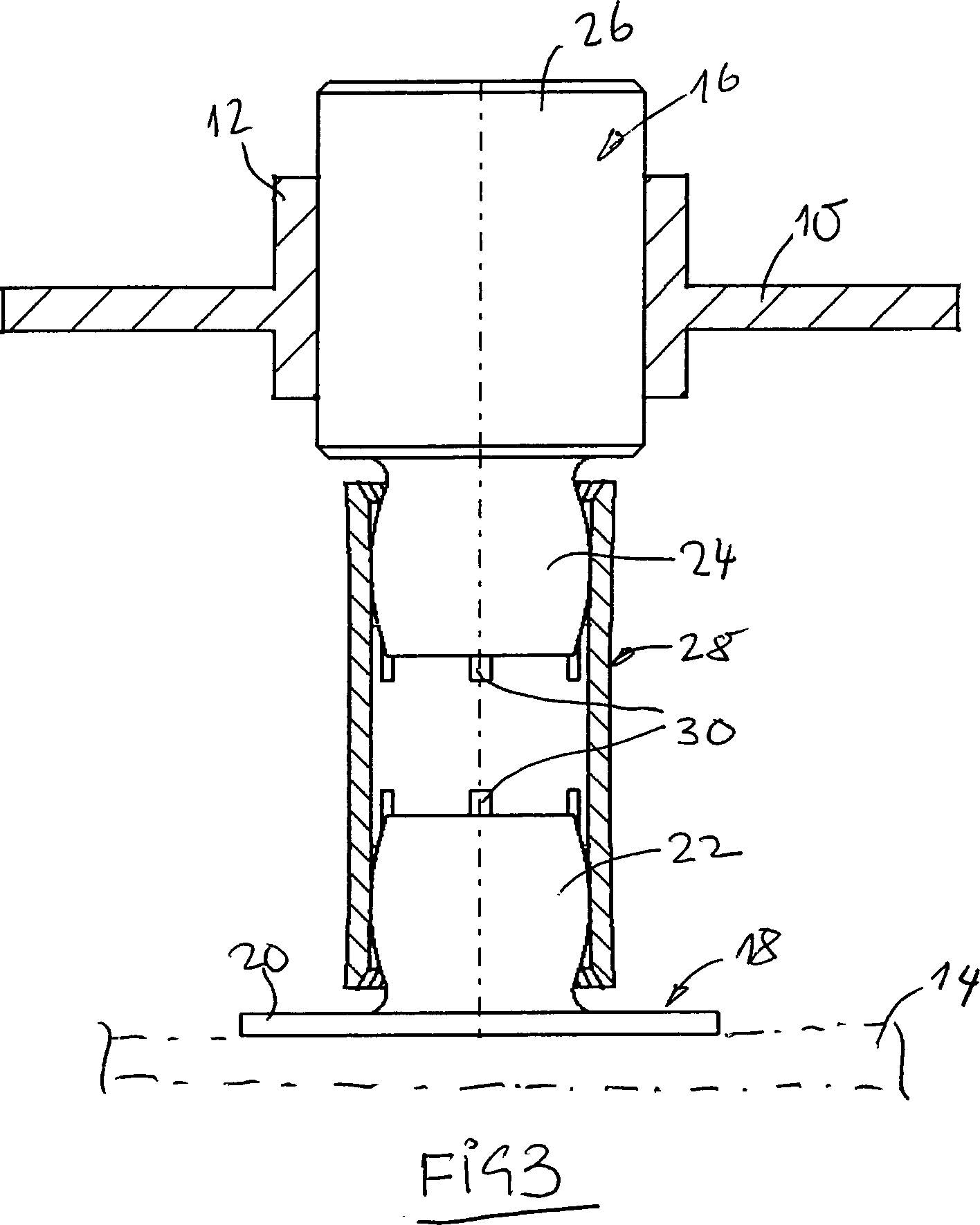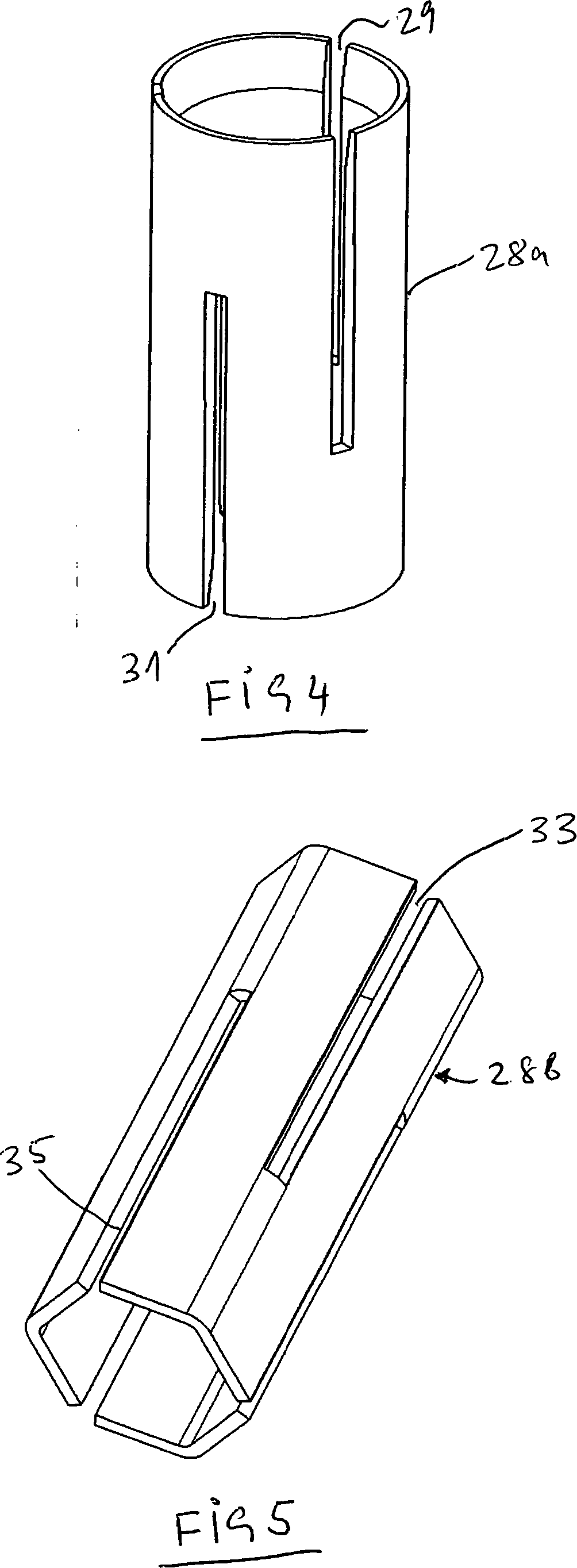Leistungsteil für einen Motor eines Flurförderzeugs
Die
Erfindung bezieht sich auf ein Leistungsteil für einen Motor eines Flurförderzeugs
nach dem Patentanspruch 1. Zur
Versorgung von mit Wechsel- oder Drehstrom betriebenen Motoren aus
einer Batterie für Flurförderzeuge
werden sogenannte Leistungsteile verwendet. Sie bestehen aus Leistungshalbleitern, die
von einem Steuerteil entsprechend gesteuert werden. Die Leistungshalbleiter
sowie auch die Steuerhalbleiter und andere Komponenten werden auf Leiterplatten
untergebracht. Es ist bekannt, bei Leistungsteilen die Leiterplatten
für den
Leistungsteil und den Steuerteil in einem geeigneten Gehäuse unterzubringen
und das Gehäuse
seinerseits an einem geeigneten Ort am Flurförderzeug zu montieren. Die Kabel
werden an das Gehäuse
herangeführt,
und es ist eine geeignete Durchführung
durch die Gehäusewandung
vorzusehen, um einen Kontakt mit der entsprechenden Leiterplatte
herzustellen. Herkömmlich werden
derartige Anschlüsse
mechanisch mit Gehäuse
und Leiterplatte verbunden durch Aufschrauben und durch Einpressen
in die Leiterplatten. Um eine möglichst
einfache Durchführung
durch das Gehäuse
zu ermöglichen,
muss das Gehäuse
sowie die Leiterplatte mit den Anschlüssen sehr genau gefertigt werden,
um eine sichere und wasserdichte Montage zu ermöglichen. Bei der Erstellung
der Anschlüsse werden
Montage und Betriebskräfte
unmittelbar auf die innen liegende Leiterplatte übertragen. Der
Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Leistungsteil für einen
Motor eines Flurförderzeugs
zu schaffen, bei dem die Stromzuführung zur Leiterplatte hin
kraftentkoppelt ist. Diese
Aufgabe wird durch die Merkmale des Patentanspruchs 1 gelöst. Bei
dem erfindungsgemäßen Leistungsteil weisen
die Leistungsanschlüsse
ein erstes durch die Wand hindurch geführtes Anschlussteil auf mit
einem innerhalb des Gehäuses
liegenden ersten Kontaktabschnitt. Ein zweites Anschlussteil innerhalb
des Gehäuses
weist einen zweiten Kontaktabschnitt auf, der mit der Leiterplatte
kontaktiert ist, beispielsweise durch Einpressen, Auflöten oder
dergleichen. Erster und zweiter Kontaktabschnitt sind zueinander
ausgerichtet, haben jedoch einen Abstand voneinander. Eine radial
elastisch aufweitbare Hülse
aus leitendem Material umgibt beide Kontaktabschnitte klemmend,
wobei die Außenkontur
der Kontaktabschnitte und die Hülse
so geformt sind, dass ein mechanischer Kontakt der Kontaktabschnitte
mit der Hülse auch
bei einer Fehlausrichtung der Kontaktabschnitte zueinander aufrechterhalten
bleibt. Bei
der Erfindung wird ein Winkelversatz zwischen den beiden Kontaktabschnitten
ermöglicht
sowie auch ein achsparalleler Versatz. Eine präzise Montage der Leiterplatte
bzw. die präzise
Ausgestaltung der Leiterplatte relativ zur Öffnung im Gehäuse ist
daher nicht mehr erforderlich. Äußere Kräfte oder Drehmomente
werden von der Gehäusewandung aufgefangen
und können
keinen schädlichen
Einfluss auf den inneren Kontaktabschnitt haben. Für die Ausgestaltung
der einzelnen Teile der Leistungsanschlüsse sind verschiedene konstruktive Möglichkeiten
denkbar. Nach einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung ist
die Außenkontur
mindestens eines der Kontaktabschnitte tonnenförmig. Die Hülse kann innen zylindrisch
sein oder einen polygonalen Querschnitt aufweisen. Eine andere Ausgestaltung
sieht in diesem Zusammenhang vor, dass die Hülse im Bereich der Kontaktabschnitte
innen eine tonnenförmige
Einbuchtung aufweist, wobei der Radius der Einbuchtung größer ist,
als der der tonnenförmigen
Außenkontur
des Kontaktabschnitts. Diese Ausgestaltung hat den Vorteil, dass
die Kontaktfläche zwischen
Hülse und
Kontaktabschnitt relativ groß ist und
somit eine gute Stromdurchleitung gewährleistet. Die
die Kontaktabschnitte klemmend umgebende Hülse ist vorzugsweise in Längsrichtung
geschlitzt (geteilt). Sie kann auch ungeteilt mit mehreren Schlitzen
geformt werden, die eine radiale Dehnung der Hülse zulassen. Nach
einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist die Hülse vorzugsweise
einteilig geformt. Sie kann jedoch auch aus mehreren Teilen zusammengesetzt
sein. Nach
einer weitren Ausgestaltung der Erfindung weist das erste Anschlussteil
einen Anschlussabschnitt auf, der in der Gehäusewandung festgelegt ist.
Dieser kann z. B. zylindrisch geformt und einteilig mit dem ersten
Kontaktabschnitt sein. Ist
die Gehäusewandung
aus Kunststoff geformt, braucht keine besondere Isolierung für den Anschlussabschnitt
vorgesehen werden. In diesem Fall kann nach einer Ausgestaltung
der Erfindung auch zweckmäßig sein,
wenn die Gehäusewandung
an den Anschlussteil angespritzt ist. Ist das Gehäuse hingegen
aus Metallblech hergestellt, muss zwischen dem Anschlussteil und
der Lochwandung eine geeignete Isolierung vorgesehen werden. Zwecks
Kontaktierung mit der Leiterplatte sieht eine weitere Ausgestaltung
der Erfindung vor, dass der zweite Kontaktabschnitt mit einem scheibenförmigen Abschnitt
verbunden ist zwecks Kontaktnahme mit der Leiterplatte. Der scheibenförmige Abschnitt
ist vorzugsweise einteilig mit dem zweiten Kontaktabschnitt geformt. Nach
einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist die Hülse zwecks
Verbindung der Kontaktabschnitte mit einem Innendurchmesser versehen,
der kleiner ist als der Außendurchmesser
der kugel- oder fassförmigen
Kontaktabschnitte. Die Hülse
ist ferner von ihren Enden ausgehend mit achsparallelen Schlitzen
versehen, die in Umfangsrichtung gleichmäßig beabstandet sind. Die Schlitze
können
entweder zueinander versetzt liegen oder auch zueinander ausgerichtet.
Im ersteren Fall ist ihre Länge
nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung etwa 2/3 der Gesamtlänge der
Hülse.
Bei einer Ausrichtung der Schlitze zueinander beträgt deren
Länge nach
einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung etwa 3/8 der Länge der
Hülsen.
Insbesondere bei der Ausrichtung der den Enden der Hülse zugeordneten
Schlitzen zueinander ist es von Vorteil, wenn die Dicke der Wandung
der Hülse
im mittleren Bereich größer ist als
zu den Enden. Dadurch werden die Kontaktenden dünner und ermöglichen
eine hohe Biegsamkeit der auf diese Weise gebildeten Kontaktfedern.
Insgesamt wird bei der Formgebung mit den Schlitzen eine Hülse erhalten,
welche im Durchmesser veränderlich ist,
ohne dass sie plastisch verformt ist. Durch die Länge der
Schlitze lässt
sich die Kontakt- und Steckkraft einstellen. Die Hülse ist
vorzugsweise kreiszylindrisch, kann jedoch auch im Querschnitt polygonal sein. Ein
Ausführungsbeispiel
der Erfindung wird nachfolgend anhand einer Zeichnung näher erläutert. In In In Das
Anschlussteil 116 weist einen zylindrischen Anschlussabschnitt 122 auf,
in dem eine axiale Gewindebohrung 124 geformt ist. Mithin
kann mit Hilfe einer Schraube ein Kabel mit dem Anschlussabschnitt 122 verbunden
werden, was hier jedoch nicht gezeigt ist. Das Anschlussteil 116 weist
außerdem
einen kugelförmigen
Abschnitt 126 auf. Das Anschlussteil 118 weist
einen scheibenförmigen
Abschnitt 128 auf, der mit der Leiterplatte 110 kontaktiert
ist. Außerdem
weist er einen kugelförmigen
Abschnitt 130 auf. Die Kugelabschnitte 126, 130 haben einen
Abstand voneinander. Sie befinden sich beide innerhalb der Hülse 120,
die im mittleren Bereich etwas eingeschnürt ist. Die kugelförmigen Abschnitte 126, 130 sind
um einen gewissen Betrag in die Hülse 120 eingepresst,
so dass eine elektrische Kontaktierung erfolgen kann. Es sei noch
erwähnt,
dass naturgemäß die Anschlussteile 116, 118 und
die Hülse 120 aus
einem geeigneten elektrisch leitenden Material, insbesondere Metall
oder Metalllegierung bestehen. Damit
die Hülse 120 zur
Verklemmung der kugelförmigen
Abschnitte 126, 130 ausreichend elastisch ist,
ist sie mit achsparallelen Schlitzen 132 geformt. In
der Darstellung nach Die
einzige Figur zeigt einen Schnitt durch einen Leistungsanschluss
für ein
Leistungsteil der Erfindung. In In
der Der
scheibenförmige
Abschnitt 20 ist einteilig mit einem Kontaktabschnitt 22 geformt,
der eine tonnenförmige
Außenkontur
hat. Das
erste Anschlussteil 16 weist einen Kontaktabschnitt 24 auf,
der zum Kontaktabschnitt 22 ausgerichtet ist und ebenfalls
eine tonnenförmige
Außenkontur
hat. Die Kontaktabschnitte 22, 24 haben einen
Abstand voneinander. Der
Kontaktabschnitt 24 ist einteilig mit einem zylindrischen
Anschlussabschnitt 26 verbunden, der sich durch den Stutzenabschnitt
nach außen
erstreckt. Er weist Mittel auf zur Verbindung mit einem Kabel, beispielsweise
einem Kabelschuh der mit Hilfe einer Schraube am Anschlussabschnitt 26 befestigt
wird, wobei dieser axial eine Gewindebohrung aufweisen kann zur
Anklemmung des Kabelschuhs (nicht angezeigt). Eine
zylindrische Hülse 28 aus
elektrisch leitendem Material, beispielsweise aus einem geeigneten
Metall, umgibt beide Kontaktabschnitte 22, 24 klemmend.
Um die Hülse 28 klemmend
aufzubringen, ist sie z. B. mit einem durchgehenden Längsschlitz
versehen. Alternativ kann sie auch als geschlossene Hülse mit
einer Mehrzahl von achsparallelen Schlitzen versehen werden, um
eine gewisse radiale Elastizität
vorzusehen. In der Figur sind z. B. bei 30 Schlitze angedeutet,
die axial zueinander ausgerichtet sind. Ihre Länge beträgt z. B. 3/8 der Gesamtlänge der
Hülse 28. Die
Hülse kann
im Querschnitt auch polygonal sein und außerdem an der Innenseite Einwölbungen
aufweisen, die sich mehr oder weniger an die tonnenförmige Außenkontur
der Kontaktabschnitte 22, 24 anschmiegen. Wie
man erkennt, ist durch die gezeigte Ausbildung des Leistungsanschlusses
eine Fehlausrichtung der Kontaktabschnitte 22, 24 sowohl
in axialer als auch in winkliger Richtung möglich, ohne dass dadurch die
Stromübertragung
beeinträchtigt
ist. Es ist daher nicht erforderlich, die Kontaktabschnitte 22, 24 exakt
zueinander auszurichten. Eine nicht genaue Anbringung des Kontaktabschnitts 22 an
der Leiterplatte 14 ist relativ zur Öffnung im Gehäuse ist
daher unkritisch. Man erkennt ferner, dass Kräfte, die bei der Montage auftreten,
beispielsweise bei der Anbringung eines Kabels, die auf das obere
Anschlussteil wirken, nicht auf das untere Anschlussteil übertragen
werden. In
den In In Es
ist auch denkbar, bei den Hülsen 28a, 28b achsparallele
Schlitze zu formen, die direkt einander gegenüberliegen bzw. zueinander ausgerichtet
sind. In diesem Falle muss ihre Länge naturgemäß kleiner sein
als die halbe Länge
der Hülse.
Sie beträgt
daher vorzugsweise 3/8 der Gesamtlänge der Hülse. Bei der zuletzt beschriebenen
Ausführungsform
ist vorzugsweise die Dicke der Wandung der Hülse im mittleren Bereich größer als
zu den Enden. Leistungsteil für einen Motor eines Flurförderzeugs, mit einem Gehäuse, mindestens einer Leiterplatte im Gehäuse, die Leistungs- und Steuerkomponenten für den Motor aufweist, und Leistungsanschlüsse für die Stromzuführung, die durch eine Wand des Gehäuses hindurchgeführt und mit der Leiterplatte kontaktiert sind, wobei die Leistungsanschlüsse ein erstes durch die Wand hindurchgeführtes Anschlussteil aufweisen mit einem innerhalb des Gehäuses liegenden ersten Kontaktabschnitt, ein zweites Anschlussteil in Kontakt mit der Leiterplatte und mit einem zweiten Kontaktabschnitt, der zum ersten Kontaktabschnitt ausgerichtet ist und einen Abstand von diesem hat, und eine radial elastische Hülse aus leitendem Material, die beide Kontaktabschnitte klemmend umgibt, wobei die Außenkontur, der Kontaktabschnitt und die Hülse so geformt sind, dass ein mechanischer Kontakt der Kontaktabschnitte mti der Hülse auch bei einer Fehlausrichtung der Kontaktabschnitte zueinander aufrechterhalten bleiben. Leistungsteil für einen Motor eines Flurförderzeugs,
mit einem Gehäuse,
mindestens einer Leiterplatte im Gehäuse, die Leistungs- und Steuerkomponenten
für den
Motor aufweist, und Leistungsanschlüsse für die Stromzuführung, die
durch eine Wand des Gehäuses
hindurchgeführt
und mit der Leiterplatte kontaktiert sind, dadurch gekennzeichnet,
dass die Leistungsanschlüsse
ein erstes durch die Wand (10, 108) hindurchgeführtes Anschlussteil (16, 116)
aufweisen mit einem innerhalb des Gehäuses liegenden ersten Kontaktabschnitt
(24, 126), ein zweites Anschlussteil (118)
in Kontakt mit der Leiterplatte (14, 110) und
mit einem zweiten Kontaktabschnitt (22, 130),
der zum ersten Kontaktabschnitt (24, 126) ausgerichtet
ist und einen Abstand von diesem hat, und eine radial elastisch
Hülse (28, 120)
aus leitendem Material, die beide Kontaktabschnitte (22, 130, 24, 126)
klemmend umgibt, wobei die Außenkontur
der Kontaktabschnitte (22, 130, 24, 126)
und die Hülse
(28, 120) so geformt sind, dass ein mechanischer
Kontakt der Kontaktabschnitte (22, 130, 24, 126)
mit der Hülse
(28, 120) auch bei einer Fehlausrichtung der Kontaktabschnitte
(22, 24) zueinander aufrecht erhalten bleiben. Leistungsteil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die Außenkontur
mindestens eines Kontaktabschnitts (22, 24) tonnenförmig ist. Leistungsteil nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
dass die Hülse
innen einen zylindrischen oder polygonalen Querschnitt aufweist. Leistungsteil nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Hülse (28) in Längsrichtung
geschlitzt ist. Leistungsteil nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Hülse einen oder mehrere Schlitze
(30) aufweist, die eine radiale Dehnung der Hülse (28)
zulassen. Leistungsteil nach einem der Ansprüche 2 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Hülse im Bereich der Kontaktabschnitte
eine tonnenförmige
Einbuchtung aufweist, wobei der Radius der Einbuchtung größer ist
als der der tonnenförmigen
Außenkontur
der Kontaktabschnitte (22, 24). Leistungsteil nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Hülse (28) einteilig
ist. Leistungsteil nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Hülse aus mehreren Teilen zusammengesetzt
ist. Leistungsteil nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass das erste Anschlussteil (16)
einen Anschlussabschnitt (26) aufweist, der in der Gehäusewandung
(10) festgelegt ist und über diese nach außen steht. Leistungsteil nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet,
dass der Anschlussabschnitt (26) zylindrisch geformt ist. Leistungsteil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die Gehäusewandung
(10) aus Kunststoff geformt und an das erste Anschlussteil
angespritzt ist. Leistungsteil nach einem der Ansprüche 9 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass Kontaktabschnitt (24) und
Anschlussabschnitt (26) einteilig geformt sind. Leistungsteil nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Kontaktabschnitt (22)
mit einem scheibenförmigen
Abschnitt (20) verbunden ist zwecks Kontaktnahme mit der
Leiterplatte (14). Leistungsteil nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet,
dass der zweite Kontaktabschnitt (22) einteilig mit dem
scheibenförmigen
Abschnitt (20) verbunden ist. Leistungsteil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die Hülse
(120) zwischen ihren Enden eine im Querschnitt bogenförmige Einschnürung aufweist. Leistungsteil nach Anspruch 5 und 7, dadurch gekennzeichnet,
dass die Hülse
(28a, 28b) einen kleineren Innendurchmesser hat
als der Außendurchmesser
des kugel- oder fassförmigen
Kontaktabschnitts (22, 24, 126, 130)
und die Hülse
(28a, 28b) von ihren Enden ausgehend achsparallele Schlitze
(29, 39, 31) bzw. (33, 35)
aufweist, die in Umfangsrichtung gleichmäßig beabstandet sind. Leistungsteil nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet,
dass die dem einen Ende der Hülse zugeordneten
Schlitze gegenüber
den gegenüberliegenden
Schlitzen in Umfangsrichtung versetzt sind ( Leistungsteil nach Anspruch 16 oder 17, dadurch
gekennzeichnet, dass die Länge
der Schlitze (29, 31) bzw. (33, 35)
etwa 2/3 der Gesamtlänge
der Hülse
(28a, 28b) beträgt. Leistungsteil nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet,
dass die den Enden der Hülse
(28) zugeordneten Schlitze (30) zueinander ausgerichtet sind. Leistungsteil nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet,
dass die Länge
der Schlitze (30) etwa 3/8 der Gesamtlänge der Hülse (28) beträgt. Leistungsteil nach Anspruch 19 oder 20, dadurch
gekennzeichnet, dass die Dicke der Wandung der Hülse im mittleren Bereich größer als
in den Endbereichen ist. Leistungsteil nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet,
dass die Dicke der Wandung sich gleichmäßig verändert.